Auf der Suche
<p>Es ist wirklich schon eine Krux der Menschen, dass sie immer gerade die Dinge zu brauchen glauben, die sie im Moment nicht zur Verfügung haben. Und üblicherweise beginnt sofort die Suche danach. Dabei sollte man grundsätzlich zwischen der Suche nach materiellen Objekten und der nach Informationen (und Zielen) unterscheiden. Jedoch kostet beides Zeit (und Nerven!).</p>

PDF Download
Zudem kann man die Unterscheidung machen, ob das Gesuchte etwas Verlorenes, Verlegtes oder Verstecktes ist, oder ob es sich um etwas Neues und Unbekanntes handelt. Letzteres ist der unentwegte Antrieb der Wissenschaften, nach Neuem und nach Lösungen von welchen Problemen auch immer zu forschen. Nicht selten werden dabei interessante Dinge gefunden, nach denen man gar nicht gesucht hat.
So ist tatsächlich auch Penizillin, eine gewisse Antibiotika-Untergruppe, auf eine Weise gefunden worden, die eher an eine Fügung denn an Zufall denken lässt. Als Alexander Fleming nämlich 1928 völlig ahnungslos, allerdings bei versehentlich offen gelassenem Laborfenster, in den Urlaub fuhr, hat er an das später entstandene Glücksprodukt nicht im Entferntesten gedacht. Denn hereingewehte Pilzsporen hatten sich an den anscheinend „herumliegenden“ Eitererregern zu schaffen gemacht und diese erledigt. Der Beginn der Erfolgsgeschichte von Antibiotika.
So hat auch der Gummireifen das Licht der Welt erst erblickt, als Charles Nelson Goodyear 1839 versehentlich ein Stück Schwefel-Kautschuk-Gemisch auf eine heiße Herdplatte fallen ließ und das erste Gummi (durch Vulkanisation) entstand. Zuvor hatte er erfolglos versucht, Naturkautschuk, der bei Wärme schmolz und bei Kälte brach, durch Zugabe von diversen Stoffen elastisch und vor allem stabil zu machen. Ohne dieses Missgeschick wären Autoreifen heute fast undenkbar.
Wir kennen das aber auch von zu Hause. Da ist man auf der Suche nach irgendeinem Gegenstand und findet etwas, das man früher einmal vergeblich gesucht hat. Nur hat der Gegenstand nun nicht mehr den damaligen Wert, und man setzt die verzweifelte Suche nach dem anderen fort. Häufig wollen wir uns auch nur versichern, dass sich eine Sache wirklich an der Stelle befindet, von der man dies annimmt. Ab und zu bewährt sich dabei auch eine Methode, die man der Interpretation der Quantenmechanik entlehnen kann, dieser vollkommen unanschaulichen und nebulösen Theorie des ganz Kleinen. Vollkommen unwissenschaftlich, aber anschaulich könnte man sagen: Je genauer man dort versucht hinzusehen, desto weniger sieht man. Oder besser: desto unschärfer wird das Bild.
Auch das kennen wir zur Genüge, denn die im Internet auf den Seiten angebotenen Bilder und Fotos haben meist eine recht geringe Auflösung und je mehr man hineinzoomt, desto „pixeliger“ wird der Inhalt. Wenn wir jetzt noch mal die Quantenmechanik bemühen, so kommt noch ein zweiter interessanter Aspekt ins Spiel. Denn es gibt dort Zustände, die es eigentlich gar nicht geben darf. Die faktischen Zustände entstehen konkret erst durch das tatsächliche Anschauen, davor sind sie eine Art Überlagerung von Ja und Nein, Schwarz und Weiß oder sogar Tot und Lebendig.

Aktuelles Magazin
Ausgabe 4/2023

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Man fühlt sich da eine wenig an die „Fuzzy Logic“ von Lotfi Zadeh aus Berkeley in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts erinnert, die eine genaue und klare Festlegung vermeiden wollte, eben „unscharfe Logik“. Daraufhin gab es eine Zeit, wo kein Fotoapparat oder Staubsauger, ohne fuzzy zu sein, am Markt eine Chance hatte. Damit sollte die an sich kompromisslose Logik „vermenschlicht“ werden. Die gerade virulente künstliche Intelligenz bedient genau diesen Aspekt, kennen doch Computer an sich nur deterministische, wohlbestimmte Algorithmen.
Das wohl bekannteste und legendäre Gedankenexperiment zu dieser Unbestimmtheit beschreibt die Katze des österreichischen Physikers Erwin Schrödinger. Deren Leben in einer Box hängt von einem wirklich mit Nichts bestimmbaren Zeitpunkt eines radioaktiven Zerfalls ab, ohne aber von außerhalb der Box etwas sehen oder hören zu können. Der Mechanismus ist tricky: Ein Hammer zerschlägt bei Zerfall eine Giftampulle und die Katze stirbt daraufhin. Bis heute ist dieses Setting ein strittiges Thema, denn der Zustand der Katze soll sich erst dann wirklich einstellen, wenn die Box geöffnet wird. Vorher ist die Gesundheit der Katze Grauzone, weder lebendig noch tot, ein gleichzeitiger Schwebezustand. Unschön ist die Vorstellung schon, wenn man sich selbst anstelle der Katze in der Box wähnt. Dann müsste man sich selbst ja die Frage stellen: Bin ich jetzt tot oder nicht? Ein Anlass zu Gedankenspielchen ohne Ende. Die Suche nach einer Lösung geht immer weiter.
Um auf den realen, aktiven Suchvorgang zurückzukommen, würde die starke Vermutung über den möglichen Ort eines vermissten Objektes ausreichen, diesen abzubrechen und in einem Nachprüfen nicht nur keinen Mehrwert zu sehen, sondern das Risiko eines Misserfolges um 100 Prozent zu verringern. Damit kehrt wieder Zufriedenheit ein, ohne Gewissheit zu haben. Das ist dann auch eine Art Schwebezustand, der uns aber diesmal gelegen kommt.
Studien und Umfragen (im englischsprachigen Raum) haben das erschreckende Ergebnis erbracht, dass wir täglich im Schnitt nach neun Sachen suchen und dafür fast eine Stunde investieren. Dies würde rund 15 Tage pro Jahr und während eines sechzigjährigen Erwachsenenlebens am Ende zweieinhalb Jahre bedeuten. Nicht mitgerechnet sind dabei digitale Suchunternehmungen auf Smartphones und Computern ebenso wie so profane Dinge wie das Suchen nach dem Sinn des Lebens oder nach einem Lebenspartner, auf welcher Beziehungsplattform auch immer. Das würde bedeuten, dass man fünfmal so viel sucht, wie man im erzwungenen Stillstand durch Stau verbringt. Würde man hierzu noch die Zeit rechnen, die wir mit Warten – auf was auch immer – verbringen (beispielsweise das Hochfahren des Computers oder das Laden von Websites), so sind damit deutlich mehr als drei Jahre Lebenszeit sinnlos verschenkt.
An der Stelle setzen dann neuerdings die Puristen mit entsprechenden Ratschlägen und Fingerzeigen an. Anstatt nach Socken, Brillen, Autoschlüsseln oder sogar ganzen Autos zu suchen, sollte man gewisse einfache Regeln beherzigen. Die oberste Regel scheint dabei auf den ersten Blick auch die sinnigste zu sein, nämlich die Menge der einen umgebenden Gegenstände drastisch zu reduzieren. Also einfach alles verschwinden lassen, was man nicht unbedingt braucht. Das führt zwangsläufig zu einer von Minimalismus geprägten Lebensweise, bei der man nach den paar Sachen, die dann übrig bleiben, eben nicht lange suchen muss. Diese sollten dann idealerweise auch noch einen festen Platz haben. Zusammengefasst gilt hier das Motto: Haste nix, biste was! Allerdings gilt auch hier die Weisheit: Wer Ordnung hält, ist zu faul zum Suchen.
Dahinter verbirgt sich tatsächlich eine ganze Bewegung, die in ihrer extremsten Form maximal 100 Dinge zulässt. Man muss sich auf dem Weg dahin von vielem trennen, auch von Sachen, an denen man vielleicht hängt. Der Tipp dazu: vor der Abgabe fotografieren (nicht jedes Foto zählt in dem Zusammenhang als Ding!). Wenn man denn doch suchen muss, gibt es auch dafür Handreichungen. So sollte man vornehmlich in unordentlichen Bereichen suchen (die ordentlichen hat man schnell überblickt). Auch Entspannung ist wichtig. Schließlich sollte man sich überlegen, ob man nach dem eventuellen Fund wirklich zufriedener ist. Wie schon beschrieben, kann man auch einfach so tun, als ob man wüsste, wo alles ist, allerdings ohne nachzuschauen.
Selbst die Wissenschaft beschäftigt sich neuerdings intensiver mit Suchvorgängen. Unter dem Stichwort „Resetting“ werden Algorithmen analysiert, die das Prinzip verfolgen, nach einer (längeren) Phase des erfolglosen Suchens einfach alles wieder auf „Null“ zu setzen und komplett von vorne zu beginnen. In der Tat verspricht ein solches Vorgehen bessere, also schnellere Resultate, da man sich dabei nicht so sehr „verzetteln“ kann und zu sehr in Details verliert.
Wobei die Forschung selbst enorm auf Quellensuche angewiesen ist. Vor vierzig Jahren war das deutlich aufwendiger. Älteren Literaturhinweisen folgend, musste man teilweise in verstaubten Archiven, untergebracht in dunklen Kellern, stöbern, um dann bleischwere Zeitschriftenjahrgänge zum nächsten Kopierer zu wuchten, um aufgrund der Krümmung der dicken Bände eine schlecht lesbare Kopie zu ziehen. Studenten von heute finden dieses archaische Recherchebild nahezu unvorstellbar, können sie doch längst mit wenigen Mausklicks fast die gesamte Welt der Fachliteratur durchforsten (und ausdrucken). Damit wird das Problem anscheinend kleiner, aber am Ende wird man bei der Suche mit möglichen Ergebnissen überschüttet. Die Zeit im Archivkeller wird mehr als überkompensiert durch das Zurechtfinden in den Datenbanken. Und da kann dann, so die Hoffnung, künstliche Intelligenz die Filterung mit den jeweiligen Kriterien übernehmen. Menschen werden in der Zukunft schlichtweg keine Zeit mehr haben, Suche und Auswahl selbst vorzunehmen.
Die Realität sieht derzeit aber anders aus. Die meiste Zeit wird mit „händischer“ Suche im Internet geradezu versemmelt. Was waren das noch Zeiten, in denen man auf andere Art gesucht hat und beim ersten Ergebnis schon zufrieden war. Heute ist die Suche nach dem günstigsten und am besten bewerteten Artikel das Ziel der Wahl. Doch die Vielfalt hat Tücken. Denn wie heißt ein so schöner Spruch: Vergleich ist der Tod der Zufriedenheit. Anders ausgedrückt: Es gibt immer etwas Besseres. Das mündet dann sogar in markige Sprüche wie (frei nach Friedrich Schiller, 1799): „Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet.“ Diese letzte Sicht der Dinge ist daher keineswegs neu.
Die Sache mit der Sucherei ist mittlerweile auch zu einem gehörigen Problem in Unternehmen geworden. Denn das Zeitkontingent dafür überschreitet häufig das im Unternehmenssinne Vertretbare teilweise deutlich. Sei es einfach das Beschaffen von Informationen oder die Konfiguration des neuen Dienstwagens, unproduktive Zeitsequenzen sind nicht erwünscht. In Zeiten von Homeoffice ist die private und dienstliche Tätigkeit sehr nahe zusammengerückt. Parallel ist da einiges möglich. Da ist das richtige Gleichgewicht noch nicht gefunden.
In Zeiten von Google- und Wikipedia-verwöhnten Nutzern ist das Finden von Informationen, zumindest als Grundlage für weitere Recherche, recht einfach geworden, allerdings immer ohne Gewähr. Dabei wirken im Hintergrund bisweilen dunkle Kräfte, die Informationen gezielt steuern und Fake News erzeugen. Die generative KI wird da in der Zukunft bestimmt noch für viel Furore sorgen. Insbesondere auch beim Verhindern von Erfolgen von Suchvorgängen tut sich Einiges. Äußerst geschickte Filter blocken Verbindungen einfach ab, die Suchvorgänge kann man als Nutzer überhaupt nicht mehr nachvollziehen.
Überdies werden Informationen, die nicht gefunden werden sollen, einfach, oder besser kompliziert, verschlüsselt. Der ganze Bereich der Kryptografie beschäftigt sich mit der Absicherung gegen Auslesen von Informationen. Die viel beschworenen Quantencomputer würden da ganz neue Möglichkeiten eröffnen, Quanten-Kryptografie ist eine Option. Derweil sich weltweit wahrscheinlich Tausende Institutionen auf die Suche nach verborgenen Informationen machen, allen voran natürliche die Geheimdienste.
Aber am Ende gibt es bei vielen Suchenden im Erfolgsmoment nicht nur Glücksgefühle, sondern auch Frust, ja fast Trauer. Die Suche an sich stellt ja auch einen erfüllenden Vorgang dar. Nicht umsonst bemerkte schon der sehr produktive Philosoph Konfuzius (551–479 v. Chr.): „Der Weg ist das Ziel.“ Konfuzius kannte aber noch keine Navigationsgeräte. Denn heute würde er eher schreiben: Das Ziel ist der (richtige) Weg. Die Frage wohin aber bleibt!
AUTOR
PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, geboren 1956 in Düsseldorf, studierte Theoretische Physik an der Universität zu Köln, an der er 1985 in Statistischer Physik promovierte. 1994 wechselte er zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 die erste deutsche Professur für Physik von Transport und Verkehr erhielt. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er an der Modellierung, Simulation und Optimierung von Transportsystemen in großen Netzwerken, besonders im Straßenverkehr, und dem Einfluss von menschlichem Verhalten darauf.
Seine aktuellen Aktivitäten umfassen Onlineverkehrsprognosen für das Autobahnnetzwerk von Nordrhein-Westfalen, die Reaktion von Autofahrern auf Verkehrsinformationen und die Analyse von Menschenmengen bei Evakuierungen.

Aktuelles Magazin
Ausgabe 4/2023

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Der nächste „Flotte!
Der Branchentreff" 2026
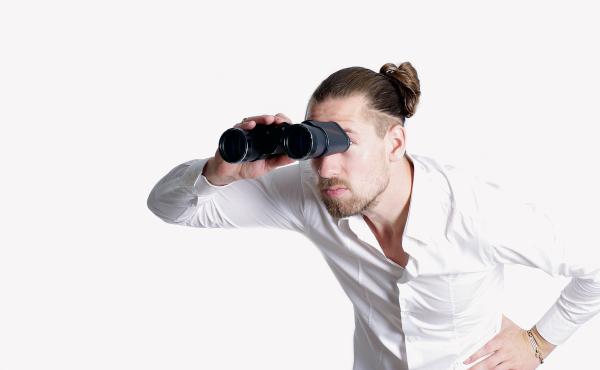
0 Kommentare
Zeichenbegrenzung: 0/2000