CO2-frei fahren mit Benzin und Diesel
<p>Nach zähen Diskussionen hat sich die Bundesregierung mit der europäischen Union darauf geeinigt, dass auch nach dem Jahr 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden dürfen, sofern sie mit E-Fuels betrieben werden. Flottenmanagement erklärt, was es mit den synthetischen Kraftstoffen auf sich hat.</p>

PDF Download
Es wurde viel gestritten in den letzten Tagen über das Thema Kraftstoffe im europäischen Parlament und in der deutschen Politik. Doch die Thematik reicht sogar noch viel weiter: Es ging und geht letztlich noch immer um nicht weniger als die Frage, ob überhaupt noch Autos mit Verbrennungsmotor zukünftig erlaubt sein würden. Wäre es nach den Grünen gegangen, hätte der Verbrenner keine Zukunft gehabt. Der Plan wäre gewesen, den kompletten motorisierten Individualverkehr künftig ausschließlich auf elektrische Antriebe auszurichten. Ein waghalsiger Plan, denn erstens gibt es nach wie vor viele Kunden, die nicht ausschließlich elektrisch unterwegs sein möchten. Und zweitens lässt sich nicht exakt voraussehen, wie sich der Markt rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge entwickeln wird vor allem angesichts diverser pessimistischer Prognosen hinsichtlich der Verfügbarkeit bestimmter Rohstoffe. Kobalt oder Lithium wären zu nennen, aber es gibt auch noch viele andere Seltene Erden (benötigt zur Batterieherstellung), die knapp werden könnten. Es gibt Studien, denen zufolge in wenigen Jahren das Lithium knapp werden könnte. Und zwar gar nicht einmal wegen der mangelnden Verfügbarkeit des Rohstoffs, sondern wegen mangelnder Förderkapazitäten. Insofern würde ein bestimmter Grad an Technologieoffenheit ja nicht unbedingt schaden.
Worum geht es in dieser Sache eigentlich genau? Das Lager pro Elektrifizierung führt an, die CO2-Emissionen könnten nur durch elektrische Antriebe auf null reduziert werden. Das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Richtig ist, dass batterieelektrische Antriebe eine hohe Effizienz aufweisen. Insbesondere die Antriebsmotoren glänzen mit einem Wirkungsgrad von deutlich über 90 Prozent. Außerdem ist es äußerst effizient, bereits produzierten Strom in einer Batterie zu speichern, statt ihn für verlustreiche Prozesse einzusetzen. Ein plastisches Beispiel kann helfen, den Sachverhalt besser zu verstehen: Um einen Liter Superbenzin unter Verwendung von CO2, Strom und Wasser synthetisch herzustellen, werden 20 kWh elektrische Energie benötigt. Mit 20 kWh hingegen fährt ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug je nach Ausführung bereits hundert Kilometer oder sogar noch weiter. Ein Benziner kommt mit einem Liter Kraftstoff vielleicht rund 20 Kilometer weit, wenn er sehr sparsam ist.
Allerdings ist die reine Effizienz nicht immer der absolute Maßstab. Werden synthetische Kraftstoffe beispielsweise dort produziert, wo Sonne und Wind reichlich vorhanden sind, verliert die Wirkungsgrad-Betrachtung an Priorität. Denn auch die Praktikabilität ist ja ein Aspekt, der sich in der gesamten Bewertung dieser Thematik wiederfinden muss.
Herkömmliche Kraftstoffe wie Benzin und Diesel haben ja noch andere Vorteile übrigens auch gegenüber Wasserstoff, der eine Vorstufe darstellt auf dem Weg zu den E-Fuels. Letzterer weist abgesehen davon auch keine ganz so rosige Wirkungsgradbilanz auf. Das ist nicht zuletzt der Grund, warum die Entwicklung bei den elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in Richtung Batterie statt Brennstoffzelle geht. Beim Wasserstoff ist abgesehen von der Herstellung auch der Transport aufwendig und energieintensiv. Dieser flüchtige Stoff muss stark gekühlt respektive unter Druck transportiert und gelagert werden, was wiederum viel Energie kostet.
Machen wir uns nichts vor. Der Beschluss, Verbrenner auch nach dem Jahr 2035 zuzulassen, sofern sie mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden, wird den Vormarsch der Elektromobilität in Europa nicht stoppen. Das Gros der Fahrzeuge wird in Zukunft elektrisch fahren. Die Bundesregierung hat verkündet, dass bis zum Jahr 2030 schon etwa 15 Millionen batterieelektrische Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein sollen. Aktuell fahren hierzulande bereits mehr als eine Million sogenannte BEV. Ein Ziel, das angesichts des wachsenden Modellprogramms elektrisch angetriebener Modelle gar nicht so unrealistisch ist. Aber auch schön zu wissen, dass sich unter den vielen Elektroautos auch noch ein paar Verbrenner tummeln werden.

Aktuelles Magazin
Ausgabe 2/2023

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Aber man muss auch wissen: Wirklich konkret ist der jetzige Beschluss noch nicht. Wie soll etwa sichergestellt werden, dass die Autos auch wirklich synthetischen Kraftstoff tanken? Allerdings geht die Diskussion an der Realität vorbei. Der Punkt ist, dass synthetische Kraftstoffe so beschaffen sind, dass sie quasi zu 100 Prozent ihren fossilen Pendants entsprechen. Das heißt im Klartext: Man kann sie fröhlich auch in jedes Fahrzeug mit Verbrennungsmotor kippen, ohne Schäden befürchten zu müssen. Denn darum geht es ja auch: den Fahrzeugbestand klimaneutral zu machen. Bedenkt man, dass bis zum Jahr 2035 Modelle mit Verbrenner noch regulär verkauft werden, fällt die Vorstellung leicht, dass selbst im Jahr 2045 noch viele Verbrenner auf unseren Straßen fahren werden.
Ja, es ist richtig, dass der Strombedarf in den nächsten Jahren steigen wird – nicht zuletzt auch, weil der Gebäudesektor mehr elektrische Energie verschlingen wird bedingt durch Wärmepumpen-Heizungen. Ein Umdenken wird stattfinden müssen: Grüne elektrische Energie wird sich nicht mehr nur lokal oder regional erzeugen lassen, sondern dort, wo die Sonne brennt und der Wind tost. Denkbar wären Regionen wie Australien, Nordafrika, Südafrika und Südamerika. Und jetzt macht der Vorschlag mit synthetischen Kraftstoffen plötzlich in doppelter Hinsicht Sinn. Denn erstens sind diese aus europäischer Perspektive weit entfernt gelegenen Orte bestens geeignet wegen des Wetters dort. Zweitens machen E-Fuels die Energie plötzlich transportfähig. Die reine Stromproduktion würde kaum helfen, denn der Strom könnte gar nicht so einfach transportiert werden. Flüssige Kraftstoffe aber, die unter erdüblichen Temperaturbedingungen einfach zu lagern sind, können problemlos per Schiff verfrachtet werden. Und da auch die Schiffe selbst künftig mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können, wäre der Transport nicht einmal umweltschädlich – jedenfalls nicht wegen der CO2-Emissionen. Die Verbrenner-Fans können jedenfalls vorerst aufatmen: Es werden nicht alle Autos elektrisch. Der EU-Beschluss spiegelt übrigens eine Mehrheitsmeinung in der deutschen Bevölkerung wider, wie viele Umfragen gezeigt haben. Jetzt bleibt abzuwarten, inwieweit er rechtsverbindlich umgesetzt wird.

Aktuelles Magazin
Ausgabe 2/2023

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Der nächste „Flotte!
Der Branchentreff" 2026



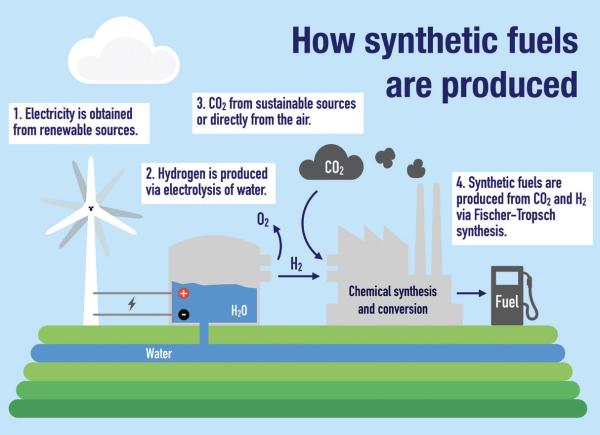
0 Kommentare
Zeichenbegrenzung: 0/2000