Verkehr(s)komplex
<p>Über den Verkehr auf unseren Straßen ist immer schon trefflich diskutiert worden. Die dabei angeschnittenen Themenbereiche waren zwar vielfältig, letztendlich aber (auch für den Einzelnen) noch „überschaubar“. Die individuelle Mobilität und die dazugehörigen Angebote wurden einfach als selbstverständlich betrachtet. Natürlich gab es auch mal Einschränkungen, man denke nur an die Ölkrisen von 1973 und 1979/1980, die zu deutlichen Rezessionen führten. Die Bevölkerung trug die Maßnahmen aber mit und die Lage entspannte sich auch nach einiger Zeit wieder.</p>

PDF Download
Doch nun sehen wir uns einer Zeitenwende ausgesetzt. Fast plötzlich scheint nichts mehr so einfach wie zuvor. Der Mensch strebt nach Konstanten und wird unruhig, wenn man ihm den Boden, oder besser die „Infrastruktur“, unter den Füßen wegzieht. Zwar gibt es Interesse an technischen Neuerungen, aber es darf nicht zu schnell sein. Und vor allem nicht zu viel auf einmal.
Ob es um die Antriebsenergie geht, um die Infrastruktur, die Daten oder die Autonomie von Fahrzeugen, überall begegnet man demselben Muster. Einerseits wächst da etwas (meistens angeblich exponentiell!), andererseits stößt man an (harte) Grenzen. Erst wächst die Infrastruktur, dann bekommt sie die natürlichen Grenzen zu spüren. Bei der Energie steigt ständig der Bedarf, aber die aktuelle Situation zeigt auch hier klare Grenzen auf. Die Daten, die aufgenommen werden, übersteigen in ihrer Menge jedes Vorstellungsvermögen, exponentiell gewachsen sind sie schon in den Bereich von Petabyte (entspricht 1.024 Terabyte oder 10 hoch 15 Byte, also eine 10 mit 15 Nullen). Kein Mensch kann das mehr sichten und auch noch analysieren, da hilft nur noch künstliche Intelligenz (KI). Bei den Autonomen (oder besser „Automatisierten“) wachsen auch hier die Daten durch die Sensorik ungebremst, noch mehr aber die Anforderungen an die Software. Nimmt man die Kommunikation noch hinzu, sind auch hier schon viele Kanäle voll, die Begrenzungen absehbar.
Nicht nur aufgrund des Datenschutzes besteht hier Diskussionsbedarf, denn die Kommunikationsnetze sind einfach als Engpässe zu sehen bei den erforderlichen Datenmengen. Man wundert sich sowieso, wie das bis heute (einigermaßen) reibungsfrei abläuft. Die Kommunikation und die Geoortung werden jetzt zudem unter den nicht mehr zur Verfügung stehenden russischen SojusTrägerraketen für Galileo-Satelliten leiden, eine Chance für die bis dato geschmähte neue Ariane 6. Da ist auf jeden Fall einiges durcheinander geraten. Und spannend wird es auf jeden Fall für die ISS-Raumstation, eine Koproduktion von NASA, ESA und Roskosmos, Zukunft ungewiss, zumal alle sonstigen wissenschaftlichen Beziehungen zu Russland beendet worden sind. Die ISS war einmal als Friedensprojekt gestartet, jetzt könnte auch sie vorzeitig auf dem „Friedhof der Raumschiffe“ landen. Die jüngsten Auseinandersetzungen von Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin und Elon Musk (SpaceX) wegen Starlink in der Ukraine lassen jedenfalls Schlimmes befürchten.
Dieses Muster von „Wachsen“ mit „Limits“ ist in der Wissenschaft schon länger ein Thema. Nicht zuletzt basiert eigentlich die ganze „Chaostheorie“ der Physik auf diesem Setting. Mit „Chaos“ ist dabei nicht der Zustand meines Schreibtisches in der Uni gemeint, sondern schon etwas Spezifischeres, also genauer mathematisch Definiertes. Der Ursprung liegt dabei in sogenannten Evolutionsgleichungen, in denen Populationen erst mal ungebremst „exponentiell“ anwachsen. Dann aber wird das Wachstum, beispielsweise durch zu wenig Nahrung oder Raum, abgebremst. Ein Zustand, den wir genauso bei der Weltbevölkerung sehen (werden). Eine einfache mathematische Relation („Logistische Gleichung“), bei der sich nach genauerer Analyse allerdings Abgründe auftun, beschreibt dies. Das Chaos, das sich hier offenbart, manifestiert sich in der recht einfachen Feststellung, dass geringste Unterschiede beim Anfangszustand praktisch nicht mehr vorhersehbare Auswirkungen auf den Endzustand haben (können). Wir kennen das von der Wettervorhersage, die für vier, drei, ja sogar manchmal zwei Tage schon deutlich an Zuverlässigkeit einbüßt.
Nimmt man diese Erkenntnisse – zugegebenermaßen ein recht weit gespannter Bogen – ernst, so droht uns da an den verschiedenen Baustellen einiges an Ungemach (was wir aber eben auch noch nicht vorhersehen können). Häufig hofft man ja auf „stabilisierende“ Faktoren, die letztendlich lenkenden Einfluss nehmen (können). Dazu muss aber die Richtung, in die gelenkt werden soll, klar sein in der Ursache-Wirkungs-Kopplung. Aber spätestens ab da ist Kaffeesatzlesen häufig deutlich zielsicherer!

Aktuelles Magazin
Ausgabe 3/2022

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Ganz so schlimm ist es am Ende (jedenfalls hier) nicht, könnte man doch direkt auf das Wachstum in einer frühen Phase einwirken oder die Grenzen variabel gestalten. Kritisch wird es erst dann, wenn man ein System sich selbst überlässt. Denn es gibt die Beispiele der „selbst organisierten kritischen“ Systeme, die sich das Leben (!) ganz von allein schwer machen. Dabei spielen eben sich selbst verstärkende Mechanismen eine wichtige Rolle. Ein einfaches Beispiel ist Stau auf der Autobahn, der sich von allein bildet, ohne einen Anlass, ohne Baustelle oder Unfall, halt ein „Stau aus dem Nichts“. Auch hier passt das Bild von Wachsen und Grenze: Der Verkehrsfluss wächst, die Kapazität der Straße bremst. Fast schon langweilig, immer das gleiche Prinzip.
Überall funktioniert es dann (leider) eben doch nicht nach dem beschriebenen Prinzip. Bekanntes Beispiel dafür ist der Krebs. Wie gerne würde man den begrenzenden Mechanismus des Wachstums und der Ausbreitung finden. Es scheint da tatsächlich Fortschritte bei der Verhinderung von Metastasen-Bildung zu geben. Sie sollen einfach „verklebt“ werden und können sich dann nicht mehr im Körper frei bewegen. Wie bei so vielen Erfolgsmeldungen sind das Nachrichten aus dem Labor, weder stressgeprüft noch marktreif. Ähnliches sieht man ja bei der Entwicklung von Batterien für E-Fahrzeuge und deren Leistungen. Man wird dann auf die nächsten Jahre vertröstet. Oft hört man dann nie mehr etwas davon.
Würde man sich den beschriebenen Themen separat widmen können, wären die Probleme klar abgegrenzt. Leider aber gibt es Interdependenzen, gegenseitige Abhängigkeiten, die das Zeug haben, am Ende alles wieder zunichtezumachen. Dabei begegnet man schnell dem Begriff der „Komplexität“. In der Umgangssprache wird „komplex“ gerne mit „kompliziert“ gleichgesetzt. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied.
In komplizierten Systemen herrschen ganz klare Zusammenhänge und Abhängigkeiten, aber es sind schlicht zu viele, um sie mit unseren Möglichkeiten beherrschen zu können. Man denke an technische Systeme, bei denen im Detail bekannte kausale Ursache-Wirkungs-Prinzipien gelten. Ganz anders dagegen gerieren sich komplexe Systeme. Die Wirkung von Eingriffen wird hier zu einer Art „Vabanquespiel“, da die kausalen Zusammenhänge nicht mehr vollständig zu durchschauen sind und alles mit allem zusammenhängt. Im Ergebnis werden dann unvorhergesehene und überraschende Ergebnisse erzeugt. Damit werden Vorhersagen natürlich äußerst schwierig oder gar nicht mehr machbar.
Man muss die Probleme einfach genauer anschauen, um zu entscheiden, ob sie auf der Grundlage der vorliegenden Fakten lösbar oder zu ungenau definiert sind. Mathematiker gehen in dieser Frage sehr rigoros vor, eine Art „Berufsethos“. Nur sauber formulierte Fragen mit klar vorgegebenen Annahmen werden überhaupt zu einer näheren Betrachtung zugelassen. Der bekannte ungarisch-stämmige Mathematiker George Pólya hat dazu ein im Internet frei herunterladbares Buch mit dem Titel „How to Solve It“ geschrieben, das sehr lehrreich ist, um generelle Probleme zu lösen.
Um das Ganze noch ein wenig abzurunden, gibt es auch zur Komplexität eine eigene Theorie, denn auch da gibt es große Unterschiede. Komplexität liegt eigentlich dann vor, wenn man viele Komponenten miteinander interagieren lässt, und dies nur auf der Basis von Regeln mit begrenzter Reichweite, also ohne Lenkung „von oben“.
So makaber das klingt, aber genau da liegt der Unterschied des Westens mit seinen Demokratien gegenüber Russland mit seiner Autokratie (oder früher: Diktatur). Dabei scheint sich die von Russland gehegte Hoffnung, Demokratien würden sich aufgrund ihrer (nicht zu beherrschenden) gesellschaftlichen Komplexität selbst destabilisieren, nicht zu bewahrheiten. Es findet auf der Welt geradezu ein Krieg der Systeme statt, das macht die Situation innerhalb der Systeme nochmals deutlich komplizierter(!).
Dabei bezieht sich die Theorie eigentlich auf die Komplexität von Algorithmen und deren Ressourcenbedarf, also Rechenzeit und Speicherplatzbedarf. Da kann man dann tatsächlich Zahlwerte für angeben. Bei weniger genau definierten Zusammenhängen, wie sie in sozialen Systemen vorzufinden sind, wird die Sache schnell „undurchsichtig“. Vergleiche werden schwieriger und die Datengrundlagen immer „schwammiger“.
Zurück zum Verkehr, dessen Komplexität eigentlich mit einem Fragenkatalog beschrieben werden kann. Überhaupt ist auch in der Wissenschaft die richtige Frage mehr wert als die Antwort auf irgendein altes Problem. Und im Verkehr haben wir nun wahrlich genügend offene Fragen, über die vom Stammtisch bis zur obersten Politik geredet, diskutiert und letztendlich entschieden wird.
Allein die Säulen unserer automobilen Verkehrsevolution, die Infrastruktur, die Antriebsenergie, die Automatisierung, die Kommunikation und die Kosten sind aller Fragen wert. Wird die Brennstoffzelle am Ende siegen? Wird es überhaupt noch Stadtverkehre geben oder werden sie unterbunden? Sind wir bald alle nur noch Beifahrer im autonomen Fahrzeug? Wird eine Pkw-Maut (City-Maut) Wirkung zeigen? Wird der ÖPNV das Rückgrat unserer Mobilität? Und der „Burner“ schlechthin: Was bringen Tempolimits (30/80/100/120/130) in Bezug auf Schadstoffausstoß, Stau, Unfälle, volkswirtschaftlichen Schaden, Akzeptanz in der Bevölkerung, ÖV-Nutzung, politischen „Suizid“
Es ist recht einfach, die verwickelte Lage beispielhaft zu demonstrieren. So scheinen sowohl der Bund als auch die Kommunen die Elektromobilität fördern zu wollen. Sobald es aber um Flächen für öffentliche Ladestationen (36 Quadratmeter für zwei) geht, werden sie „schmallippig“. Diese Flächen sind dann ja zweckgebunden und nicht mehr wirklich öffentlich. Nach der gerade veröffentlichten 2. HUK-Coburg-Mobilitätsstudie ist die individuelle Fortbewegung mit dem Auto mit fast 70 Prozent bei Weitem das Mittel der Wahl, und das auch in Zukunft. Das Elektroauto ist dabei eindeutig auf dem Vormarsch. Aber hier zeigen sich auch schon lokale Grenzen. Die vielen privaten Wallboxen in wohlhabenderen Gegenden, häufig aus unbekannten Gründen nicht angemeldet, sorgen dort eventuell für Netzausfälle. Die Stadtnetze sind darauf einfach nicht vorbereitet.
Die Kopplung unserer automobilen Mobilität an den Spritpreis scheint nicht sehr eng. Wie die erwähnte Studie schon zeigt: Das Auto bleibt beliebt, und das nicht in der Garage. Klimawandel hin oder her, Energieproblematik zur Kenntnis genommen, aber für nicht schwer genug befunden, und der ÖV bleibt (auch nach 9-Euro-Ticket) irgendwie unterirdisch (was sehr teuer ist!).
Die Anforderungen an den Verkehrsteilnehmer steigen ständig. Nicht exponentiell, aber sie steigen. Aber auch hier gibt es Grenzen. Und am Ende fehlt der Durchblick aufgrund der komplexen Zusammenhänge. Sollte man sich überfordert fühlen, so ist das kein Einzelfall. Es soll böse Zungen geben, die behaupten, im Verkehrsministerium sei das der Normalfall. Schon seit vielen Jahren.
AUTOR
PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, geboren 1956 in Düsseldorf, studierte Theoretische Physik an der Universität zu Köln, an der er 1985 in Statistischer Physik promovierte. 1994 wechselte er zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 die erste deutsche Professur für Physik von Transport und Verkehr erhielt. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er an der Modellierung, Simulation und Optimierung von Transportsystemen in großen Netzwerken, besonders im Straßenverkehr, und dem Einfluss von menschlichem Verhalten darauf.
Seine aktuellen Aktivitäten umfassen Onlineverkehrsprognosen für das Autobahnnetzwerk von Nordrhein-Westfalen, die Reaktion von Autofahrern auf Verkehrsinformationen und die Analyse von Menschenmengen bei Evakuierungen.

Aktuelles Magazin
Ausgabe 3/2022

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Der nächste „Flotte!
Der Branchentreff" 2026
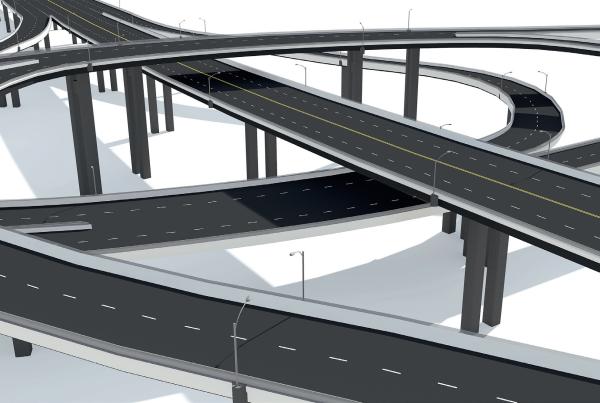

0 Kommentare
Zeichenbegrenzung: 0/2000