Wenig Auswahl in der Upperclass
<p>Etwas mehr als ein Prozent der Gesamtzulassungen entfallen auf das Segment der Oberklasse. Sie bildet quasi die Speerspitze der Automobilklassifi zierung. In keiner anderen Fahrzeugkategorie wird so viel Fahrkomfort und Luxus geboten wie hier. Oberklassevehikel sind daher prädestiniert für den Einsatz auf langen Strecken. Im 117. Kostenvergleich fi nden verstärkt auch Ausführungen mit Plug-in- Hybrid-Antriebssträngen Berücksichtigung und werden erstmals auch beim Vergleich behandelt. In der Oberklasse hat sich viel getan in den letzten zwei Jahren. Sie ist übrigens kein rein deutsches Phänomen, auch wenn die Modellauswahl genau das suggeriert. Doch mehr dazu im Text. So viel sei gespoilert: Wie beim letzten Mal ist auch diesmal wieder der <strong>Audi A7</strong> Champion.</p>

PDF Download
Mit der Oberklasse ist das so eine Sache – oftmals wird die Abgrenzung zwischen oberer Mittelklasse, häu g auch Businessklasse genannt, und echter Oberklasse nicht präzise vorgenommen. Auch diesmal hat sich wieder eine obere Mittelklasse in die Oberklasse-Listung des Kraftfahrt-Bundesamts gemogelt – nämlich der Maserati Ghibli. Diese Information soll vollständigkeitshalber nicht unterschlagen werden, aber in Bezug auf die Stückzahlen ist das völlig zu vernachlässigen. Gerade einmal 14 Exemplare des Ghibli wurden im Dezember letzten Jahres zugelassen.
Man könnte meinen, die Oberklasse sei ein deutsches Phänomen und es stimmt auch so ein bisschen: Vorwiegend Mercedes-Benz, BMW, Audi und Porsche sind hier unterwegs. Maserati hat mit dem Quattroporte zwar ein starkes Angebot im Segment, allerdings spielt der in Deutschland noch weniger eine Rolle als der kleinere Ghibli. Auch Jaguar, traditionell in der Oberklasse vertreten, muss diesmal passen. Das liegt einfach daran, dass der XJ aktuell nicht mehr gebaut wird. Die Briten entwickeln derzeit neue Elektroauto-Plattformen und man kann sich einigermaßen sicher sein, dass sie künftig wieder in dieser luxuriösen Liga vertreten sein werden. Den würdigen Lexus LS behandeln wir im Kasten auf S. 72 gesondert – er macht im Vergleich nicht mit, weil er weder als Diesel noch als Plug-in-Hybrid zur Verfügung steht. Die Oberklasse ist übrigens noch bunter: Genesis hat mit dem brandneuen G90 gerade eine luxuriöse Limousine vorgestellt, sie bleibt dem europäischen Markt allerdings bisher vorenthalten.
Noch ein paar Worte zu den im Vergleich aufgeführten Fahrzeugen: Eigentlich sind die Modelle Audi A7 und Mercedes-Benz CLS keine echten Oberklasse-Limousinen. Sie werden allerdings vom Kraftfahrt- Bundesamt in dieser Kategorie geführt. Und man muss sagen, dass sie innerhalb der Markenfamilien eine exponierte Stellung einnehmen und deutlich exklusiver sind als die entsprechenden Limousinen der Businessklasse, auf deren Plattformen sie basieren. Allerdings sei auch der Hinweis erlaubt, dass Kunden mit dem Wunsch nach maximalem Komfort, möglichst leisen Fahrgeräuschen (durch aufwendige Dämmung erzielt) und einem Maximum an Technologie auf eine „echte“ Oberklasse zurückgreifen müssen. Das ist auch der Grund, warum die Mitglieder dieser Liga teurer sind. Da der Schwerpunkt unserer Wertung allerdings auf dem Kostenaspekt liegt, werden es die Oberklassemodelle nur schwer auf die vorderen Plätze schaffen. Die Hersteller scheuen keine Kosten und Mühen, um sie zu technologischen Flaggschiffen zu entwickeln. Es gibt noch einmal mehr Platz im Fond als bei den Kandidaten A7 und CLS und man kann eine fondorientierte Ausstattung wählen – dann halten Dinge wie Klapptische, eigene Monitore oder Hightech-Sitze Einzug in die zweite Reihe. Auch die Möglichkeit, mit der Order der entsprechenden Langversionen noch mehr Beinfreiheit hinten zu schaffen, ist der Oberklasse vorbehalten. Dafür sind die knapp unter fünf Meter langen Teilnehmer A7 und CLS wendiger zu handhaben und generell fahraktiv ausgelegt. Auch der Nutzwert ist höher – wenn man die Sitzlehnen des A7 umklappt, schluckt er immerhin knapp 1.400 Liter Gepäck. Eine klassische Luxuslimousine kann das nicht, hier darf man froh über einen 500 Liter fassenden Kofferraum sein.
Doch trotz hoher Ziele hat sich Flottenmanagement bei der Auswahl der Fahrzeuge in Bescheidenheit geübt: Bei den Diesel-Kandidaten mussten aus Effizienzgründen die Basismodelle mit kurzem Radstand und Hinterradantrieb herhalten. Audi bietet allerdings ausschließlich Allradantrieb für den A8. Der CLS geht mit dem kleinsten Sechszylinder an den Start, Vierzylinder-Diesel sind einer Oberklasse nicht würdig, demnach geht auch der Audi A7 mit einem Sechszylinder-Selbstzünder an den Start. Bei Mercedes handelt es sich im konkreten Fall um den CLS 400 d 4Matic – wegen hoher Leistungs- und Drehmomentwerte ausschließlich mit zwei angetriebenen Achsen zu bekommen. Allerdings ist der starke CLS auch preislich ein exklusives Vergnügen – das und sein kleiner Tank sowie die infolgedessen geringe Reichweite in Kombination kosten ihn einen der vorderen Plätze.
Man muss sagen, dass der Diesel in diesem Segment noch immer eine ideale Motorisierung darstellt. Er ist sparsam, reichweitenstark, kräftig – und läuft leise wie kultiviert. Solange reine Elektroantriebe in weiten Teilen der Langstrecken- Zielgruppe noch auf Vorbehalte stoßen (und das tun sie derzeit), bleibt der Diesel ohne Alternative. Oder etwa doch nicht? Zumindest hat Flottenmanagement ebenfalls einen genaueren Blick auf die Plug-in-Hybride geworfen, von denen es im Segment mehr gibt als vor zwei Jahren und vor allem in besserer Form. Besonders deutlich wird das am S 580 e, der mit seiner Akkugröße von knapp 30 kWh geradezu beeindruckt. Das sind Dimensionen, die vor Kurzem noch für rein elektrisch angetriebene Kleinwagen gut waren. Gewichtiger Nachteil der PHEV-Oberklassemodelle ist, dass man mit ihnen gleich schon in die Spitzenregionen der Kategorie vorstößt. Ein S 350 d kostet mit 84.490 Euro netto schon alles andere als wenig Geld – der S 580 e jedoch erfordert mindestens 106.580 Euro. Auch in den Betriebskosten macht sich das bemerkbar. Wer 50.000 Kilometer im Jahr zurücklegt, muss im Falle der Selbstzünder-S-Klasse monatlich schon jede Menge Geld berappen, und zwar 2.030 Euro netto für Leasing und Betriebskosten. Der Plug-in-Hybrid verschlingt mit 2.480 Euro netto monatlich in der gleichen Kategorie schon ein Viertel mehr – das ist selbst im Umfeld besser betuchter Bürger viel Geld. Natürlich, mit einer Leistung von 510 PS wildert der 580 e schon im Gefilde hochmotorisierter Sportgefährte. Doch nicht jeder (auch) ökologisch angehauchte Interessent möchte solch überbordende Leistungswerte. Auch bei Audi, BMW und Porsche sind die PHEV-Versionen immer zwingend mit hohen Leistungsdaten verknüpft, die irgendwo zwischen 400 und 500 PS angesiedelt sind. Allein der etwas niedriger positionierte A7 lässt sich auch als Plug-in-Hybrid mit knapp unter 300 PS ordern. Wir haben uns in diesem Kontext zwecks besserer Vergleichbarkeit allerdings für die 367 PS starke Variante entschieden.
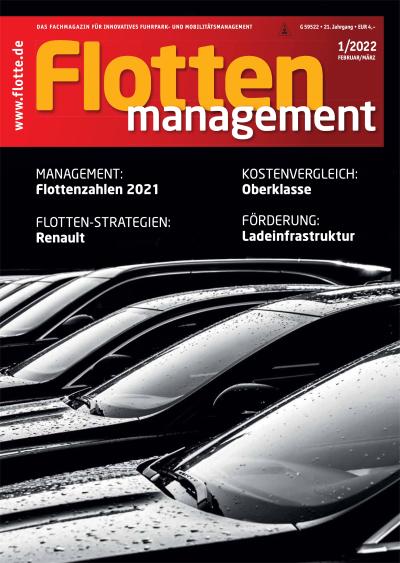
Aktuelles Magazin
Ausgabe 1/2022

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Auch beim dritten PHEV-Vergleich hat sich die Redaktion die Mühe gemacht, die realen Betriebskosten zu ermitteln – nach dem Schlüssel 30 Prozent Fahranteil im rein elektrischen und 70 Prozent Antriebsanteil im hybridischen Betrieb. Weiterhin geht Flottenmanagement basierend auf der empirischen Beobachtung davon aus, dass die Fahrzeuge etwa fünf Mal so viel Kraftstoff verbrauchen wie der nach dem WLTPVerbrauchszyklus ermittelte Wert, der einen in der Praxis meist nicht abgebildeten Fahranteil ohne Verbrennungsmotor unterstellt. Anders als bei früheren Gegenüberstellungen zeigt sich, dass die Entwicklung verschiedener Hybride voranschreitet. So glänzt die S-Klasse mit einem sensationell niedrigen Benzinverbrauch, was daran liegt, dass der reale elektrische Fahranteil in der Praxis höher ausfällt als bei den Wettbewerbern mit kleinerem Akku. Über 100 Kilometer können auch tatsächlich ohne Verbrenner zurückgelegt werden – das sind nicht nur Werte auf dem Papier.
Dennoch – unter reinen Kostengesichtspunkten lassen sich die Oberklassefahrzeuge mit Dieselantrieb deutlich günstiger realisieren, und das gilt für jedes einzelne Modell. Allerdings gibt es auch durch die Bank weg mehr Performance, so muss sich der Kunde entscheiden, was er am Ende möchte. Auch ein A7 50 TDI, der hier klarer Preischampion ist, kann mit seinen 286 PS sicher nicht als schwachbrüstig bezeichnet werden. Hier liegt man in der 20.000-Kilometer-Betrachtung selbst inklusive Betriebskosten bei „nur“ 989 Euro netto monatlich. Der teuerste Hybrid schlägt unter gleichen Bedingungen mit 1.980 Euro netto zu Buche – das macht deutlich, welch große monetäre Bandbreite hier gegeben ist. Allerdings handelt es sich beim Mercedes auch um das jüngste, mit Technik vollgestopfte Modell.
Keine wirklichen Schwächen leisten sich sämtliche Vergleichskandidaten beim Thema Ausstattung. Autonome Notbremsung und Navigationssystem sind immer vorhanden. Die Features, die Oberklassemodelle imstande sind zu bieten, gehen weit über jene hinaus, die ein Geschäftswagen haben sollte. Wir haben die Maßstäbe natürlich leicht angepasst – wer in der Luxuskategorie unterwegs ist und folglich tendenziell eher viele Kilometer am Stück abspult, sollte keinesfalls ohne perfekten Sitzkomfort auf die Straße. Dazu gehört auch eine Massagefunktion, die nur der Audi A8 je nach Konfiguration frei Haus bietet. Und bitte nicht davon irritieren lassen, dass dieses Goodie für die S-Klasse nicht zu haben ist – hier zeigen die raumgreifenden Lieferprobleme in der Halbleiterindustrie leider ihre (negative) Wirkung. Dass ein adaptiver Tempomat in dieser Liga zum Grundrüstzeug gehört, sehen nur Audi und BMW so – die restlichen hier vertretenen Marken verlangen zwischen 1.588 und 1.930 Euro netto. Jeder Hersteller hat so seine eigene Vorstellung davon, was er für zwingend oberklassewürdig hält. So erachtet BMW das Head-up-Display für nicht verzichtbar und gibt es seinen Siebener-Kunden frei Haus mit auf den Weg. Ähnlich verhält es sich mit dem schlüssellosen Schließsystem, für das Mercedes (1.200 Euro) und Porsche (690 Euro) zusätzliches Geld sehen möchten. Für A8 und 730d ist es kostenlos, A7-Kunden jedoch werden mit 705 Euro extra zur Kasse gebeten, obwohl es sich hierbei um ein äußerst komfortspendendes Extra handelt.
Zum Thema Mehrwertausstattung in der Oberklasse könnte man Bände füllen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Preislisten teilweise über hundert Seiten stark sind. Audi schießt mit 136 Seiten den Vogel ab, während es BMW gelingt, sein Angebot kompakt auf weniger als 40 Seiten darzustellen. Dennoch hat Flottenmanagement vor allem Fahrwerkfeatures wie Luftfederung und Hinterachslenkung als angemessene Mehrwertausstattung herausdestilliert, die die durchaus ausgefeilten Fahreigenschaften noch einmal betonen – unbedingt benötigt werden sie hingegen nicht. Das gilt auch für die elektrische Heckklappe und adaptive Scheinwerfer, wobei Letztere natürlich ein Sicherheits-Plus sind. Immerhin: LED-Scheinwerfer bieten alle Kandidaten durch die Bank weg ohne Aufpreis. Wer beim Budget etwas freizügiger ist, der kann in der Oberklasse – und das ist eines der Segment-Spezifika – vor allem die zweite Reihe so richtig luxuriös ausstatten. Als Beispiel sind die beinahe schon zwinausufernden Möglichkeiten des Fond-Enter- und -Infotainments zu nennen mit eigenen Bediener- Boards, leistungsstarken Soundsystemen und Touchscreens. Solche Dinge sind übrigens der „echten“ Oberklasse vorbehalten – hier müssen A7 oder CLS passen. Dafür glänzen die mit etwas mehr Praxistauglichkeit, geben je nach Kon guration sogar die Lademeister mit ihren umklappbaren Rückbänken (435 Euro netto beim CLS, frei Haus beim A7). Dass alle hier verglichenen Fahrzeuge in puncto Fahrkultur und Komfort über alle Zweifel erhaben sind, steht übrigens außer Frage.
And the winner is … Audi A7
So haben wir gewertet
Der Flottenmanagement-Kostenvergleich setzt sich aus fünf Hauptkriterien – den Kosten über Laufzeit und -leistung, den technischen Daten, den flottenrelevanten Daten, der Ausstattung und den einmaligen Kosten beim Kauf – zusammen. Dabei erhält das jeweils günstigste Modelle eine grüne und das teuerste eine rote Markierung. Ebenfalls werden flottenrelevante Fakten wie die Dichte des Servicenetzes und die Garantiezeiten grün beziehungsweise rot markiert und dementsprechend bewertet. Die technischen Daten eines jeden Modells werden unter den Gesichtspunkten des Durchschnittsverbrauchs in l/100 km laut WLTP- Fahrzyklus (zurückgerechnet auf NEFZWerte), des CO2-Ausstoßes in g/km, der Reichweite in km sowie der Ladungsdaten – Kofferraumvolumen in l, maximales Laderaumvolumen in l und Zuladung in kg – beurteilt und entweder mit Grün für die Bestwerte beziehungsweise Rot für die schlechtesten Werte gekennzeichnet.
Daneben wird eine besonders lange Laufzeit der Fahrzeuggarantie mit einem Pluspunkt respektive einer grünen Markierung hervorgehoben. Falls dienstwagenrelevanten Ausstattungsmerkmale nicht lieferbar sind, werden diese rot gekennzeichnet und dementsprechend gewertet. Eine grüne Kennzeichnung im Bereich Ausstattung kann aufgrund einer hohen Anzahl an serienmäßig verbauten dienstwagenrelevanten Ausstattungselementen beziehungsweise einer Mehrwertausstattung erzielt werden, ebenso erfolgt eine Negativwertung bei einer geringen Anzahl. Bereits zum dritten Mal hat die Redaktion den Versuch unternommen, die Treibstoffkosten für Plugin- Hybride realistisch darzustellen. Dabei legen wir einen konservativen elektrischen Fahranteil von 30 Prozent zugrunde und stützen uns auf die Strom- Verbrauchsangaben der Hersteller. Der verbleibende Fahranteil von 70 Prozent wird hybridisch absolviert – hier unterstellen wir ausgehend vom werksangegebenen Gesamtverbrauch (mit hohem elektrischen Fahranteil) den Faktor Fünf. Dieser Wert ist realistisch, wie wir auf unseren selbst durchgeführten Verbrauchsrunden über die letzten Jahre ermittelt haben. Die Hürde bei den PHEV, mehr Strecke elektrisch zurückzulegen, bilden nicht nur die teils geringen Akkukapazitäten, sondern ebenso mangelnde Lademöglichkeiten.
Dienstwagenrelevante Ausstattung im Segment der Oberklasse:
• Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer und Beifahrer (Front-, Kopf- und Seitenairbags)
• adaptiver Tempomat
• aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage
• Nachtsichtassistent
• Parksensorik
• Klimaautomatik
• LED-Scheinwerfer
• Smartphone-Integration
• Navigationssystem
• Rückfahrkamera
• Massagesitze
• Sitzheizung vorn
• Schlüsselloses Schließsystem
• Totwinkel-Assistent
• Head-up-Display
Mehrwertausstattung im Segment der Oberklasse- Limousinen:
• elektrische Heckklappe
• Luftfederung
• volladaptive Scheinwerfer / LED-Matrixlicht
• Hinterachslenkung
Ein veritabler Oberklässler aus Japan, der leider nicht am Vergleich teilnehmen konnte, ist der Lexus LS 500h – und das, obwohl er auf dem deutschen Markt verfügbar ist. Der Grund liegt schlicht in der Antriebseinheit. Unter seinem Blech arbeitet ein 264 kW/359 PS starker Vollhybridstrang, dessen Traktionsbatterie sich allerdings nicht extern aufladen lässt – nennenswerte rein elektrische Strecke macht der LS also nicht. Stark genug ist seine E-Maschine mit 132 kW/179 PS allemal und so boostet der Stromer den 5,24-Meter-Brocken zusammen mit einem 3,5-Liter- V6-Motor zackig auf 100 km/h – in 5,4 Sekunden. Mit einem Gesamtverbrauch von etwas mehr als sechs Litern darf der Luxusliner als sparsam durchgehen und bekommt immerhin die Effizienzwertung A+. Der LS 500h kostet ab 81.302 Euro netto. Und wie bei japanischen Autos üblich, verfügt auch der Top-Lexus über eine üppige Ausstattung. So sind schon in der Basis nahezu alle dienstwagenrelevanten Positionen am Start.
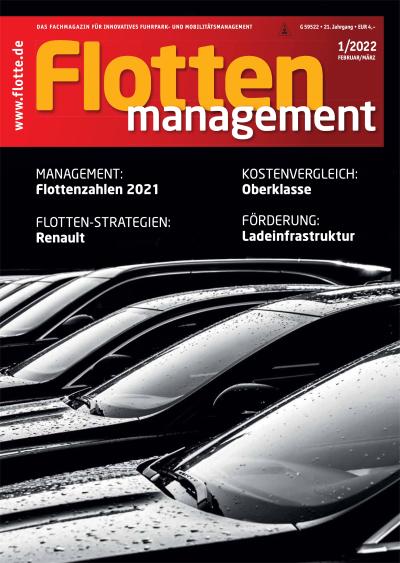
Aktuelles Magazin
Ausgabe 1/2022

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Der nächste „Flotte!
Der Branchentreff" 2026



0 Kommentare
Zeichenbegrenzung: 0/2000