Elektrifizierung leichter Nutzfahrzeuge. On the road again – mit nachhaltigen Transportern
<p>Sei es das Lieferfahrzeug des Paketdienstleisters, der Werkstattwagen des Servicetechnikers oder der Materialtransporter eines Handwerkers – leichte Nutzfahrzeuge prägen das Bild auf deutschen Straßen. Noch häufig mit Benzin- oder Dieselmotor betrieben, stellen Umweltzonen und Fahrverbote in Städten für Leichtlastkraftwagen zunehmend eine Herausforderung dar. Denn obwohl E-Transporter bereits seit mehr als zehn Jahren auf dem deutschen Markt verfügbar sind, sind sie im Vergleich zum E-Pkw sowohl in Bezug auf die Entwicklung als auch das Marktwachstum auf der Strecke geblieben. Wie also die Elektrifizierung von Transporterflotten erfolgreich umgesetzt werden kann, beschreibt der Gastbeitrag von Katharina Schmidt, Head of Consulting & Arval Mobility Observatory & Leitung Fuhrpark bei der Arval Deutschland GmbH.</p>

PDF Download
Laut des Arval Mobility Observatory Fuhrparkund Mobilitätsbarometers 2021 setzen immerhin bereits 26 Prozent der befragten deutschen Unternehmen auf Plug-in-Hybrid-, 23 Prozent auf Hybrid- und 27 Prozent auf Elektrofahrzeuge in ihren Flotten. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland bei der Elektrifizierung der Transporterflotte damit sogar vorne (zum Vergleich: PHEV: 20 %, Hybrid: 21 %, BEV: 19 %). Nichtsdestotrotz zögern Unternehmen aus verschiedenen Gründen mit dem Umstieg auf alternative Antriebsmethoden in ihren Transporterflotten. Zu Unrecht, denn die Elektrifizierung leichter Nutzfahrzeuge lohnt sich und lässt sich unter Beachtung gewisser Faktoren ebenso gut gestalten wie für Pkw.
Der Umwelt und dem Geldbeutel zuliebe Leichte Nutzfahrzeuge machen mit rund 27 Millionen Fahrzeugen etwa ein Zehntel der verkehrsbedingten CO2-Emissionen in Europa aus. Grund genug, dass Unternehmen über die Elektrifizierung dieser Fahrzeuge nachdenken sollten. Auch wenn die CO2-Grenzwerte für die Fahrzeughersteller höher sind als für Pkws, senken nachhaltige Antriebe die Umweltbilanz des Fuhrparks und tragen damit zu einem positiven Firmenimage bei. Zudem können schadstoffarme Nutzfahrzeuge die Gesamtkosten im Fuhrpark senken. Weiterhin erleichtern steuerliche Anreize und diverse Vergünstigungen wie Umweltbonus, Innovationsprämie oder kfw-Förderung die Anschaffung elektrifizierter leichter Nutzfahrzeuge. Zwar sind gleichwertige Dieselmodelle auch nach Abzug des Umweltbonus noch immer etwas günstiger als elektrifizierte Transporter. Doch aufgrund der geringeren Wartungs- und Instandhaltungskosten profitieren Unternehmen von niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Ausschlaggebend dafür ist, dass Elektrofahrzeuge über weniger bewegliche Teile verfügen als Diesel- oder Benzinfahrzeuge, die bei stetiger Nutzung schneller verschleißen. Durch die steigenden Treibstoffkosten können zudem Kosteneinsparungen bei der Energiewahl realisiert werden.
Hybrid, Plug-in-Hybrid oder vollelektrisch?
Ist die Entscheidung zur Elektrifizierung der Transporterflotte gefallen, müssen Unternehmen sich für eine elektrifizierte Antriebsvariante entscheiden. Laut des Arval Mobility Observatory Fuhrpark- und Mobilitätsbarometers 2021 sind komplett batteriebetriebene Fahrzeuge bisher weniger gefragt: Ein Viertel der befragten deutschen Unternehmen gab an, vollelektrische Transporter nicht in Betracht zu ziehen. Die Gründe dafür liegen vor allem in einer begrenzten Anzahl öffentlicher Ladepunkte sowie in fehlenden Lademöglichkeiten bei Mitarbeitenden zu Hause. Aber auch vergleichsweise hohe Anschaffungskosten und eine begrenzte Modellauswahl spielen bei der Entscheidung eine Rolle. Andererseits lässt sich feststellen, dass die prozentualen Werte bei den oben genannten Gründen im Vergleich zum Vorjahr niedriger geworden sind. Denn auch im Hinblick auf die Flächenabdeckung der Ladeinfrastruktur entwickelt sich das Angebot rasch weiter.
Unsicherheitsfaktor Reichweite
Nichtsdestotrotz spielt nach wie vor die Reichweite des elektrifizierten Fahrzeugs eine große Rolle für Unternehmen, wenn es darum geht, die Transporterflotte zu elektrifizieren. Grundsätzlich dient der vom Hersteller angegebene WLTP-Wert (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) als gute Bewertungsgrundlage. Dennoch ist die Reichweite gerade bei E-Transportern von diversen äußeren Faktoren abhängig:
• Temperatur: Ähnlich wie bei Verbrennern wirkt sich die Außentemperatur auch bei elektrifizierten Fahrzeugen auf die Leistung aus. Zum einen nimmt bei Kälte der Innenwiderstand der Batterie zu, sodass weniger Energie entnommen werden kann. Zum anderen fließt mehr Energie in die Heizung des Fahrzeugs. Hier entpuppt sich gerade die Luftheizung als größter Verbrauchsfaktor. Bei Wintertemperaturen liegt die realistische Reichweite etwa 30 bis 40 Prozent unter dem angegebenen WLTP-Wert. Aber nicht nur Kälte, sondern auch der Betrieb der Klimaanlage im Sommer verkürzt die Reichweite des Fahrzeugs.
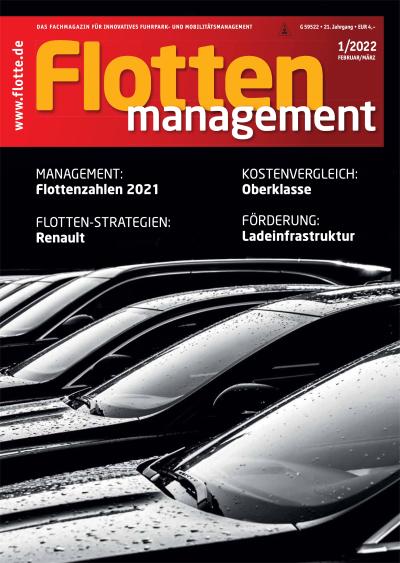
Aktuelles Magazin
Ausgabe 1/2022

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
• Fahrweise: Auch hier gibt es Parallelen zu Verbrennerfahrzeugen. Denn ähnlich wie bei der Dieselvariante wirkt sich der Fahrstil auf die Leistung und damit auf die Reichweite eines elektrifizierten Transporters aus. Für eine maximale Reichweite empfiehlt sich eine vorausschauende und defensive Fahrweise, bei der starke Beschleunigungsmanöver vermieden werden. Darüber hinaus ist auch die Wahl einer angemessenen Geschwindigkeit entscheidend: E-Transporter sind bei mittleren Geschwindigkeiten auf Landstraßen am effizientesten und erreichen dabei durchschnittlich 82 Prozent der angegebenen WLTP-Reichweite. Bei langsamen Geschwindigkeiten im Stadtverkehr ist mit Ergebnissen von etwa 68 Prozent und 61 Prozent auf der Autobahn zu rechnen.
• Nutzlast: Erstaunlicherweise spielt das Gewicht in Bezug auf die Reichweite bei E-Transportern eine eher untergeordnete Rolle. So sind zwischen einem voll beladenen und einem leeren Fahrzeug Unterschiede von lediglich acht Prozent des WLTPWerts zu erwarten. Damit bewegt sich das Verhältnis Gewicht zu Reichweite in einem ähnlichen Rahmen wie bei Dieselfahrzeugen. Für Fuhrparkverantwortliche bedeutet das, keine Abstriche bei Aus- und Einbauten des Nutzfahrzeugs machen zu müssen. Ein möglicher Grund für die geringen Unterschiede liegt in der Energierückgewinnung durch Bremsvorgänge. Hier wirkt sich ein höheres Gewicht sogar positiv aus.
Vor der Anschaffung die Ladeinfrastruktur prüfen
Anhand der Einflussfaktoren zur Reichweite lässt sich bereits eine erste Auswahl an elektrifizierten Fahrzeugen treffen, die für die unternehmenseigene leichte Nutzfahrzeugflotte infrage kommen. Bevor es aber an die Bestellung der Transporter geht, gilt es, noch ein paar offene Fragen zu klären. Allem voran ist es wichtig, die Ladeinfrastruktur zu prüfen. Besteht die Möglichkeit, auf dem Betriebsgelände Ladesäulen zu installieren, sind Unternehmen gut beraten, in eine eigene Ladeinfrastruktur zu investieren. Sie bringt nicht nur wirtschaftliche und steuerliche Vorteile mit sich, sondern setzt auch ein deutliches Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das zahlt auf ein positives Firmenimage ein und macht das Unternehmen attraktiv für Nachwuchskräfte. Gerade bei Betrieben mit mehreren Fahrzeugen sollten dazu im Vorfeld die Anforderungen an die Ladeinfrastruktur genau definiert werden. So vermeiden Unternehmen im Zweifelsfall teure Nachrüstungen und können ihre Ladelösungen auch zukunftsfähig aufstellen. Kehren die Mitarbeitenden beispielsweise zum Feierabend auf das Betriebsgelände zurück und können ihre Fahrzeuge über Nacht dort laden, bieten sich Wechselstrom- Ladestationen an. Werden die Fahrzeuge allerdings tagsüber für Aufträge eingesetzt, bei denen es schnell gehen muss, wie beispielsweise Lieferservices, sollten Unternehmen durchaus prüfen, ob eine leistungsstärkere Schnellladesäule die bessere Alternative ist.
Zudem empfiehlt sich, die täglichen Routen oder Einsatzgebiete der Fahrenden näher zu betrachten und dabei folgende Fragen zu beantworten: Wann und wo können die Fahrzeuge gegebenenfalls unterwegs aufgeladen werden? Reicht die Akkuladung des Firmenwagens für einen ganzen Arbeitstag? Wo werden über den Tag Stopps eingelegt und stehen an diesen Orten bereits Ladestationen für E-Fahrzeuge zur Verfügung? So eignet sich beispielsweise für einen Servicetechniker, der für Kundentermine viel über Land fahren muss, eher ein Plug-in-Hybrid als Werkstattwagen, wohingegen ein Paketdienstleister im Stadtverkehr besser auf einen batterieelektrischen Transporter zurückgreifen kann.
Die Mitarbeiter ins Boot holen
Neben den Anforderungen an Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur darf aber auch die Belegschaft nicht vergessen werden. Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen kann es mitunter schwer sein, die Mitarbeitenden von alternativen Antriebsformen zu überzeugen. Fuhrparkverantwortliche sind daher gut beraten, bei der Elektrifizierung der Transporterflotte auf offene und transparente Kommunikation zu setzen und Mitarbeitende bereits zu Beginn des Projekts abzuholen. So können beispielsweise Gesprächsrunden, Workshops sowie Testfahrten oder -zeiträume mit elektrifizierten Transportern helfen, Vorbehalte abzubauen und Sorgen oder Ängste zu nehmen. Firmeninterne Workshops und Schulungen eignen sich zudem hervorragend, um Mitarbeitenden die Besonderheiten elektrifizierter Fahrzeuge und die damit verbundenen Anforderungen näherzubringen. Abschließend bieten spezielle Fahrsicherheitstrainings, die sich auf einen sicheren und umweltfreundlicheren Fahrstil fokussieren, einen zusätzlichen Mehrwert. In diesen Workshops und Sessions lernen Fahrende nicht nur vorausschauend und sicher, sondern ebenfalls nachhaltig und umweltbewusst zu fahren. Das bedeutet neben weniger Unfällen auch eine wirtschaftlichere Flotte.
In der Ruhe liegt eine nachhaltige Zukunft
Spätestens seit der Dieselkrise und den damit verbundenen Fahrverboten sind Unternehmen gezwungen, über alternative Antriebe in ihren Flotten nachzudenken – auch bei den leichten Nutzfahrzeugen. Und die Nachfrage nach E-Mobilität wächst. Auch im Hinblick auf gesellschaftliche und klimapolitische Entwicklungen sind Betriebe gut beraten, in einen nachhaltigen Fuhrpark zu investieren. Mit einem zuverlässigen Partner an ihrer Seite sind sie in der Lage, den Fuhrpark nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen. Mobilitätsexperten wie beispielsweise Leasinggesellschaften verfügen über umfassendes Know-how, das insbesondere im Bereich der Elektromobilität notwendig ist, um mit den fortlaufenden technischen Veränderungen Schritt halten zu können. Zudem entwickeln sie in enger Abstimmung mit allen Beteiligten maßgeschneiderte Konzepte, um den Fuhrpark nach den vorhandenen Möglichkeiten zu elektrifizieren. Denn bei aller Bereitwilligkeit, die Flotte nachhaltig aufzustellen, dürfen Unternehmen nicht vergessen: Die Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge ist ein komplizierter Prozess, der nicht von heute auf morgen erfolgt.
AUTORIN
Katharina Schmidt, Head of Consulting, Arval Mobility Observatory & Leitung Fuhrpark, Arval Deutschland, ist seit über 20 Jahren in der Automobilbranche bei Arval Deutschland tätig. Ihre Zuständigkeitsbereiche betreffen das Mobilitäts-Consulting, Arval Moblility Observatory sowie den Arval Dienstwagenfuhrpark. Sie ist dafür verantwortlich, dass Kunden, Interessenten und Partner von Arval die passenden Denkanstöße, Informationen, belastbare Berechnungen und Analysen bei ihren individuellen Fuhrpark- und Mobilitätsthemen im Einklang mit den ökonomischen als auch umweltfreundlichen, nachhaltigen Zielen erhalten und somit die richtigen Entscheidungen für den Fuhrpark und das Unternehmen treffen können.
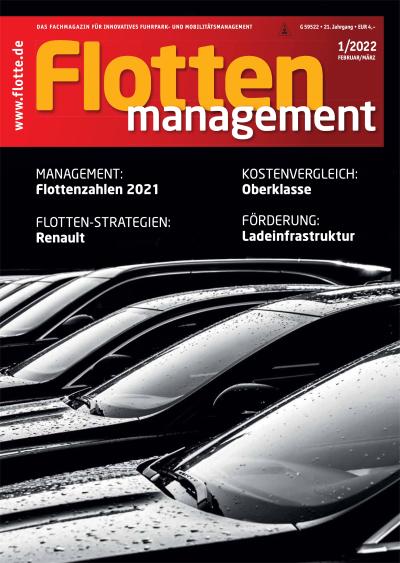
Aktuelles Magazin
Ausgabe 1/2022

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Der nächste „Flotte!
Der Branchentreff" 2026


0 Kommentare
Zeichenbegrenzung: 0/2000