Steuerliche Fallstricke beim Fahrzeugleasing
Geschäftsfahrzeugleasing hat sich seit vielen Jahren etabliert. Für die Hersteller stellen Finanzierung und Leasing wichtige Absatzförderinstrumente dar. Für den Firmenkunden bieten Mietkauf und Leasing ein komfortables Kreditsubstitut zur Durchführung betrieblich notwendiger Investitionen in den Fuhrpark.

PDF Download
Grundsätzlich könnte man erwarten, dass auch die steuerrechtliche Behandlung von Mietkauf oder Leasing auf gesicherter Rechtsgrundlage steht. Für die bilanzsteuerrechtliche Behandlung kann dies wegen der sogenannten Leasing- Erlasse des Bundesfinanzministers auch sicher bejaht werden. Dennoch wartet die Finanzverwaltung immer wieder mit Überraschungen auf, die unter Umständen zu steuerlichen Mehrbelastungen im Zusammenhang mit Mietkauf oder Leasing führen können.
Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen von Leasingraten
Im Zuge der Unternehmenssteuerreform 2008 hat der Steuergesetzgeber die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungstatbestände neu geregelt. Waren bis dahin nur die Zinsen für Dauerschulden, also langfristiger Kredite, zur Hälfte dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen, so sind nunmehr nicht nur alle Kreditzinsen, sondern auch Miet- und Pachtzinsen einschließlich Leasingraten für die Benutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen, zu umgerechnet fünf Prozent in die gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage mit einzubeziehen (§ 8 Gewerbesteuergesetz). Hintergrund dieser Regelung war es, die in den Miet- und Pachtzinsen oder aber Leasingraten enthalten Zinsteile pauschal zu erfassen und somit den Kreditzinsen im engeren Sinne gewerbesteuerlich gleichzustellen.
Im Rahmen steuerlicher Außenprüfungen vertreten die Betriebsprüfer nunmehr die Auffassung, dass neben den eigentlichen Leasingraten auch die vom Leasingnehmer getragenen Kosten für Reparaturen, Instandhaltung (Inspektionskosten) und Versicherung, die dieser über die gesetzlichen Pflichten hinaus aufgrund vertraglicher Verpflichtung übernommen hat, in die Hinzurechung einzubeziehen sind. Dabei stützen sich die Finanzbeamten auf den gleichlautenden Ländererlass vom 4. Juli 2008 zur Hinzurechung von Finanzierungsanteilen. Laufende Betriebskosten wie Treibstoffkosten sollen jedoch nicht unter die Hinzurechnungsvorschrift fallen. Nach dem Entwurf eines Schreibens des Bundesfinanzministeriums vom 30. August 2011 wird diese Auffassung nochmals gestützt und zum Teil konkretisiert. Demnach soll auch die LKW-Maut nicht hinzurechungspflichtig sein, was bis dahin ebenfalls ernsthaft von der Finanzverwaltung vorgesehen war.
Welche Zinsen in Reparaturkosten oder Versicherungen enthalten sein sollen, vermag man wohl als Kaufmann kaum nachvollziehen. Auch bietet meines Erachtens das gesetzgeberische Ziel, Finanzierungsbestandteile in Mieten oder Leasingraten zu erfassen, für die dargestellte Verbreiterung der Bemessungsgrundlage keinen Raum.
Daher sollte eine Erfassung solcher Kosten bei der Ermittlung des Gewerbeertrags durch die Finanzämter nicht widerspruchslos hingenommen und durch Einspruch angefochten werden. Verwiesen werden kann dabei auf ein bereits anhängiges Verfahren (FG Rheinland-Pfalz, Az. 1 K 2461/11) sowie auf den Vorlagebeschluss des Finanzgerichts Hamburg (Az. 1 K 138/0) an das Bundesverfassungsgericht, welches die Verfassungsmäßigkeit der Hinzurechung von Zinsen und Mieten anzweifelt.

Aktuelles Magazin
Ausgabe 3/2012

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Umsatzsteuerliche Behandlung von Sale-and-Mietkauf-back
Bei der Beschaffung von Firmenfahrzeugen kommt es nicht selten vor, dass der Firmenkunde zunächst das Fahrzeug unmittelbar beim Händler erwirbt und im Anschluss an das Fahrzeuggeschäft mit einem Finanzierer einen Mietkaufvertrag abschließt (Sale-and-Mietkauf-back). Der Firmenkunde verkauft also seinerseits das Fahrzeug an den Finanzierer weiter, der wiederum das Fahrzeug im Falle des Mietkaufs an den Firmenkunden zurückveräußert.
Betreffend die Umsatzsteuer wäre anzunehmen, dass der das Fahrzeug liefernde Firmenkunde dem Finanzierer eine Rechung mit Umsatzsteuerausweis ausstellt, so dass dieser auch den entsprechenden Vorsteueranspruch hat. In der Mietkaufrechung wiederum stellt der Finanzierer dem Firmenkunden eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis, welche den Firmenkunden zum Vorsteuerabzug berechtigt. So ist dies auch in etlichen Fällen in der Praxis geschehen. Es ist auch offenbar, dass sich die jeweilige Umsatzsteuerschuld mit dem jeweiligen Vorsteuererstattungsanspruch zu Null saldiert.
Das höchste deutsche Finanzgericht hat jedoch bereits im Jahre 2006 entschieden, dass Saleand- Mietkauf-back umsatzsteuerrechtlich nicht als Lieferung zu behandeln sind und daher keine Rechungen mit Umsatzsteuerausweis auszustellen sind (BFH-Urteil vom 9.2.2006, V R 22/03). Nach Auffassung der Richter kommt der Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums an dem Gegenstand eine bloße Sicherungs- und Finanzierungsfunktion zu, da die Verfügungsmacht an diesem Gegenstand nicht auf den Finanzierer übergegangen ist.
Soweit es jedoch zu der Rechungserteilung wie zuvor beschrieben gekommen ist, hat dies neben einem sehr hohen Verwaltungsaufwand steuerliche Folgen: Der Firmenkunde schuldet die Umsatzsteuer aus der von ihm gestellten Rechnung nach § 14 c Abs. 2 UStG weiter, während der Finanzierer die unberechtigt geltend gemachte Vorsteuer zurückzuzahlen hat. Der Finanzierer seinerseits schuldet die von ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer ebenfalls nach § 14 c Abs. 2 UStG weiter, der Firmenkunde hat dem Finanzamt die zu Unrecht gezogene Vorsteuer zurückzuüberweisen.
Wegen des zeitlichen Auseinanderfallens von Vorsteuerkorrektur und Umsatzsteuerkorrektur kann es zu Nachzahlungszinsen nach § 233a AO kommen. Zudem kann durch Rechnungsberichtigungen auf Antrag die nach § 14 c Abs. 2 UStG jeweils geschuldete Umsatzsteuer seitens des Finanzamts zurückverlangt werden, wenn das Steueraufkommen insgesamt nicht gefährdet ist. Letztes kann dann der Fall sein, wenn einer der Vertragspartner zwischenzeitlich beispielsweise wegen Insolvenz seine steuerlichen Pflichten nicht mehr erfüllen kann.
Es ist also darauf zu achten, dass im Falle von Sale-and-Mietkauf-back-Transaktionen keine Rechungen mehr mit offenem Umsatzsteuerausweis ausgestellt werden.
Nachträglicher Bestelleintritt
Ähnlich gelagert und mit den selben umsatzsteuerlichen Folgen stellt sich der Fall des nachträglichen Bestelleintritts dar.
Der Firmenkunde bestellt zunächst ein Fahrzeug beim Händler. Nach Auslieferung tritt der Finanzierer in den Kaufvertrag ein. Der Händler schreibt eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis an den Finanzierer, der seinerseits im Falle des Mietkaufs eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis an den Firmenkunden ausstellt.
Nach den von der Finanzverwaltung aufgestellten Grundsätzen (BMF-Schreiben vom 5.8.2009) können die Vertragspartner mit umsatzsteuerlicher Wirkung nur bis zum Zeitpunkt der Ausführung der Lieferung ausgetauscht werden. Erfolgt der Eintritt erst nach der physischen Auslieferung des Fahrzeugs an den Firmenkunden, so
- ist die Lieferung des Händlers umsatzsteuerrechtlich an den Firmenkunden erfolgt,
- erfolgt kein Zurückdrehen der ursprünglichen Lieferung vom Händler an den Firmenkunden,
- kommt es umsatzsteuerrechtlich zu einem Sale-and-Mietkauf-back-Geschäft zwischen Firmenkunden und Finanzierer.
Der Händler schuldet daher neben der in der Rechung an den Finanzierer falsch im Sinne von § 14 c Abs. 2 UStG ausgewiesenen Umsatzsteuer auch die Umsatzsteuer aus der Lieferung des Fahrzeugs an den Firmenkunden.
Der Firmenkunde schuldet die Umsatzsteuer aus der Weiterlieferung des Fahrzeugs an den Finanzierer und hat die Vorsteuer zurückzuzahlen, die der Finanzierer ihm im Falle eines Mietkaufs in Rechung gestellt hat.
Der Finanzierer hat die nach § 14 c Abs. 2 UStG falsche Umsatzsteuer aus dem Mietkauf an den Firmenkunden und die unberechtigt gezogene Vorsteuer aus der Rechnung des Händlers zu zahlen.
Es liegt auf der Hand, dass hier ein aufwendiges Berichtigungskarussell in Gang gesetzt werden muss, um letztlich den Vorgang für alle Beteiligten wieder umsatzsteuerneutral zu gestalten. Wegen des zeitlichen Auseinanderfallens zwischen Umsatzsteuerentstehung, unberechtigtem Vorsteuerabzug und Rechtsfolgen aus den Rechungsberichtigungen kann es zu Festsetzung von Nachzahlungszinsen nach § 233a AO kommen, obwohl keiner der Beteiligten letztlich einen Liquiditätsvorteil hatte.
Größer werden kann der Schaden zudem, wenn einer der Beteilgten zwischenzeitlich die wirtschaftlichen Aktivitäten beendet hat und die Finanzverwaltung den nachträglichen Bestelleintritt erst Jahre später aufdeckt.
Für die Jahre bis einschließlich 2009 hat auch für den Fall des nachträglichen Bestelleintritts das Bundesfinanzministerium die Finanzbehörden angewiesen, die Fälle nicht zu beanstanden. Für die Zukunft gilt es aber sicherzustellen, wann beziehungsweise anhand welcher Kriterien der Bestelleintritt erfolgt und dass die physische Auslieferung an den Firmenkunden dem Bestelleintritt nachgelagert ist.
Umsatzsteuerliche Behandlung von Wertminderungsentschädigungen
Unfallschäden führen regelmäßig auch zu einer Minderung des Fahrzeugswerts, welcher durch die Kfz-Versicherungen ausgeglichen wird. Im Falle des Fahrzeugleasings ist regelmäßig der Leasingnehmer Versicherungsnehmer. Der Leasinggeber hat als Eigentümer den Anspruch auf Ausgleich des merkantilen Minderwerts und vereinnahmt die von der Versicherung geleistete Wertausgleichzahlung.
Mit Urteil vom 01.03.2000 hatte der Bundesgerichtshof (Az. VIII ZR 177/99) entschieden, dass es sich bei dem Minderwertausgleich, den der Leasinggeber geltend macht, nicht um Schadensersatz, sondern um ein weiteres Entgelt für die Gebrauchsüberlassung des Gegenstands an den Leasingnehmer handelt.
Diese Rechtsprechung hat sich die Finanzverwaltung zu eigen gemacht und sieht demzufolge in der Wertminderungsausgleichzahlung einen umsatzsteuerpflichtigen Leistungsaustausch zwischen Leasinggeber und Leasingnehmer (BMFSchreiben vom 20.02.2006 sowie 22.05.2008).
Führt der Leasingnehmer ebenfalls umsatzsteuerpflichtige Umsätze aus, so hat dieser den entsprechenden Vorsteuerabzug. Für Privatpersonen oder die Unternehmer, die keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze ausführen, kann dies zu einer Mehrbelastung führen, es sei denn, die Versicherung gleicht die Umsatzsteuer aus.
Zwischenzeitlich hat der Bundesgerichtshof mit Urteilen vom 14.03.2007 (VIII ZR 65/06) und 18.05.2011 (VIII ZR 260/10) seine Rechtsprechung aus dem Jahre 2000 geändert und festgestellt, dass entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung ein Minderwertausgleich nicht umsatzsteuerpflichtig ist.
Das Niedersächsische Finanzgericht (Urteil vom 02.12.2010, Az. 5 K 224/09) hat sich der BGHRechtsprechung angeschlossen und erblickt in der Wertminderungsausgleichszahlung ebenfalls einen nicht umsatzsteuerbaren Schadensersatz. Folgt der zur Revision angerufene Bundesfinanzhof (Az. XI R 6/11) dieser Auffassung, so kann dies wiederum nachträglich zur Versagung des Vorsteuerabzugs aus der Rechung des Leasinggebers über den Wertminderungsausgleich kommen, und wieder wird ein Berichtigungskarussell mit allen negativen Begleiterscheinungen in Gang gesetzt.
Fazit: „Warum nicht kompliziert, wenn’s auch einfach geht?“ – die vorstehenden Sachverhalte zeigen wieder, dass es kein Licht am Ende des Steuertunnels gibt, welches Anlass zur Hoffung auf eine Steuervereinfachung gibt. Der Steuergesetzgeber täte gut daran, die Steuergesetze insgesamt präziser zu gestalten und hinsichtlich der Umsatzsteuer für Transaktionen zwischen umsteuersteuerpflichtigen Unternehmen eine generelle Steuerbefreiung einzuführen. Es wäre ein gewaltiger Beitrag zum Abbau von Bürokratie in Unternehmen.
Autor
Der Autor: Wolfgang Küster ist geschäftsführender Gesellschafter bei der Dr. Dornbach & Partner GmbH in Koblenz. Neben der Wirtschaftsprüfung stellt die steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung der mittelständischen Klientel Schwerpunkt seiner Tätigkeit dar. Unternehmen der Automobil-Branche sowie Produktions- und Großhandelsunternehmen gehören zu den von Wolfgang Küster betreuten Mandanten. DORNBACH ist derzeit mit 17 Standorten in Deutschland vertreten (www.dornbach.de).

Aktuelles Magazin
Ausgabe 3/2012

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Der nächste „Flotte!
Der Branchentreff" 2026
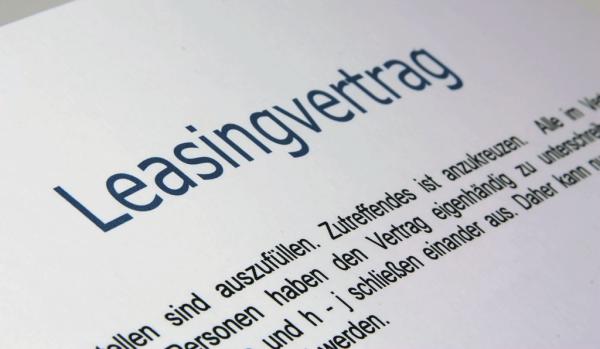

0 Kommentare
Zeichenbegrenzung: 0/2000