Eine sorgfältige Abwägung...
...ist auch im Jahr eins nach der Finanzkrise notwendig, wenn es um die Beurteilung geht, ob Leasing oder Kauf die geeignete Finanzierungsform für den Fuhrpark ist.

PDF Download
Fast möchte man glauben, es handele sich allein um eine Frage der Philosophie. So unterstreichen die Befürworter des Leasings unter den Flottenbetreibern gern das unkompliziertere Handling, alle drei oder vier Jahre werden ihnen neue Fahrzeuge auf den Hof gestellt, die sie einfach nach Ende der Laufzeit wieder an den Leasinggeber zurückgeben. Sie müssen sich keine Gedanken um die Wiedervermarktung der Gebrauchtwagen machen, dieses erhebliche Risiko – anders lässt es sich gegenwärtig kaum noch ausdrücken – liegt beim Leasinggeber.
Über die Laufzeit zahlen sie eine fest vereinbarte monatliche Rate für die Nutzung der Fahrzeuge, zumindest auf den ersten Blick sind damit die Kosten klar überschaubar. Auf Wunsch können sie im Rahmen eines mehr oder minder ausgebauten Full Service-Leasings verschiedene, im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Fahrzeugs anfallende Kosten wie beispielsweise Wartung und Verschleiß, Reifenersatz oder die Tankkarte in den Leasingvertrag einschließen, zu ebenfalls fest vereinbarten monatlichen Raten. Das klingt doch einfach.
Im Gegensatz dazu halten die Betreiber von Kauffuhrparks gern den Eigentums-Gedanken hoch, “was mir ist, ist mir”. Oft verkörpert sich darin auch eine Unternehmens-Philosophie aus der jeweiligen Gründerzeit. Darüber hinaus propagieren sie gelegentlich den bilanztechnischen Vorteil eines gekauften Fuhrparks, der im Anlagevermögen zu Buche schlage und dadurch das Rating des Unternehmens gegenüber den Banken verbessere, will sagen, die Chancen, bei Bedarf von dort großzügiger mit (weiteren) Krediten bedient zu werden.
Im übrigen lasse sich ein gekaufter Fuhrpark flexibler im Hinblick auf schwankende Mitarbeiter- Stämme dirigieren, weil ein gekauftes Fahrzeug jederzeit wieder verkauft werden könne, während hingegen ein einmal geschlossener Leasingvertrag über eine Laufzeit deutlich schwieriger auszuhebeln sei. Hier sei der Fuhrparkbetreiber bis zu einem gewissen Grad auch auf den Goodwill des Leasinggebers, den Eigentümer der Fahrzeuge, angewiesen. In der Praxis würden häufig eigentlich nicht mehr benötigte Fahrzeuge bis zum Ende des jeweiligen Leasingvertrags in einer Art Fahrzeug-Pool zur besonderen Verwendung übernommen, weil das vom Handling her noch eine der weniger komplizierten Varianten sei.
Angespannte Marktsituation
Bis zum Beginn der unseligen Finanzkrise vor einem Jahr und den weiter andauernden Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Lage war im Flottenmarkt ein stetig anhaltender Trend in Richtung Leasing zu beobachten, das Kaufen kam mehr und mehr aus der Mode. Dann hatten gewissenlose Banker die Uhren komplett anders gestellt, und schon sieht sich auch die Leasingbranche in Deutschland nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) „mit voller Wucht getroffen”.
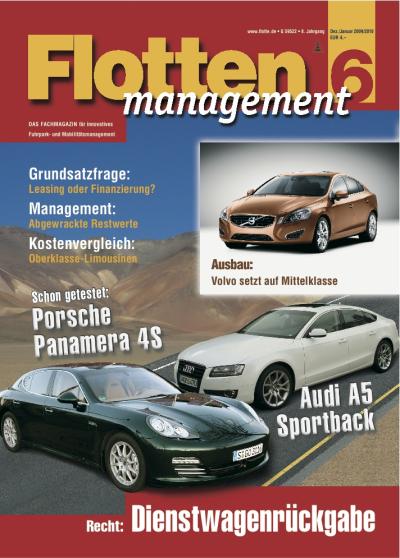
Aktuelles Magazin
Ausgabe 6/2009

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Sie erlebt den dramatischsten Rückgang in ihrer 47-jährigen Geschichte. Mit einem Volumen von 39,3 Milliarden Euro ist das Mobilien-Leasing (Fahrzeuge, Maschinen, IT) um stramme 22,7 Prozent zurückgegangen. „In bisherigen Krisensituationen hatte Leasing stets eine stützende bis investitionsfördernde Wirkung, was an steigenden Leasing-Quoten, also am Leasing- Anteil an den Ausrüstungsinvestitionen, zu sehen war”, beschreibt BDL-Präsident Martin Mudersbach die Lage. „In diesem Jahr verringert sich jedoch die Mobilien-Leasingquote leicht auf 21,1 Prozent.”
Ursachen hierfür seien in erster Linie die schwierige Refinanzierungssituation für die Leasinggesellschaften, ausgelöst durch das jetzt (natürlich) noch restriktivere Verhalten der Banken bei der Kreditvergabe, und die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 2008. „Die Leasinggesellschaften sind im Wettbewerb mit den Kreditinstituten benachteiligt, die von der Politik zugesagte Gleichstellung bei der Gewerbesteuer ist de facto nicht vollzogen worden”, führt Mudersbach weiter aus. „Eine aktuelle Umfrage unter den BDL-Mitgliedern hat ergeben, dass rund zwei Drittel der unabhängigen Gesellschaften ihr für das zweite Halbjahr 2009 geplante Neugeschäft aufgrund von Refinanzierungsengpässen einschränken mussten. Dies gilt sogar für 36 Prozent der bankenabhängigen Leasing-Unternehmen.”
Strafverschärfend kommt gegenwärtig auf jeden Fall für die Fahrzeugleasing-Branche hinzu, dass sich hier viele Leasinggeber aus Wettbewerbsgründen über Jahre mit der permanenten Kalkulation geschönter Restwerte gegen alle Gesetze der Mathematik und der Wahrscheinlichkeit geradezu verzockt haben.
Erste Schock-Reaktionen: das bewusste Verlieren von Ausschreibungen mit potenziellen Neukunden, damit nicht eines Tages noch mehr gebrauchte Fahrzeuge zurückkommen, die sich jetzt schon kaum noch wiedervermarkten lassen. Mit eiserner Disziplin konsolidiert sich die Branche gerade. „Wir haben doch jahrelang geglaubt, es ginge immer weiter nach oben”, sagte dieser Tage noch der Geschäftsführer einer herstellerunabhängigen Leasinggesellschaft.
Kaum besser ergeht es momentan aber auch dem von der Finanzkrise direkt betroffenen Bankgewerbe, das jetzt allerorten sein Heil erst einmal in der generellen Geschäftspolitik noch teurerer Kredite, bei gleichzeitig noch geringeren Verzinsungen von Geldanlagen sucht. Für welche Art der Finanzierungsform soll sich aber nun in solcher Gesamtlage der Flottenbetreiber entscheiden
Insbesondere Barkauf sichert beste Verhandlungspositionen
Auf den ersten Blick scheint jetzt die Summe vieler Anzeichen für den Kauf zu sprechen, der bei einem detaillierten, direkten Kostenvergleich beider Finanzierungsformen unter Berücksichtigung aller Aspekte meistens ohnehin die Oberhand gewinnt. Wenn denn mit (seriösen) Wertpapieren und vergleichbaren Geldanlagen im Hinblick auf den Zinsertrag derzeit kein Staat mehr zu machen ist, dann bieten sich für eine sinnvolle Geldanlage eigentlich nur noch Sachwerte an. Vorausgesetzt, das Geld für den Kauf ist zumindest zu einem hohen Prozentsatz vorhanden und kann zum Zweck des Fahrzeugkaufs auch eingesetzt werden, weil es nicht an anderen Stellen im Unternehmen benötigt wird.
Auch die Finanz-Experten großer Automobilclubs, wie des ADAC oder des Auto Club Europa (ACE), werden nicht müde darauf zu verweisen, dass der Kauf gegen Bargeld natürlich die günstigste Finanzierungsform bleibe, weil hier weder Zinsen, noch Gebühren anfallen würden, und er immer noch gegenüber den Autohändlern die beste Verhandlungsposition im Hinblick auf höchstmögliche Rabatte garantiere.
„Wenn der Kauf komplett bar nicht möglich ist, sollte zumindest möglichst viel Bargeld aufgebracht werden”, rät auch Max Herbst von der FMH-Finanzberatung in Frankfurt, „Je niedriger der Finanzierungsanteil, desto geringer auch die zusätzlichen Kosten für die Tilgung des Darlehens. Gerade auch im Nachgang zur Finanzkrise spricht momentan Vieles für einen Barkauf, wobei hier aber auch schon eine relativ schnelle Reaktion des Kunden gefordert ist, weil vor allem die Autobanken gerade die Kreditzinsen erhöhen. Hier ist auch von einer weiter steigenden Tendenz auszugehen. Grundsätzlich aber stehen beim Barkauf Kunde und Händler, der die Fahrzeuge auch finanzieren muss, mit am besten da.”
Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Denn wer Fuhrpark-Fahrzeuge kauft, hat die Wiedervermarktungs- Problematik am Hals, die kaum je zuvor größer war als jetzt. Nach jüngsten Studien stehen nahezu 40 Prozent der Autohändler Anfang 2010 wegen des eklatanten Restwerte- Verfalls vor der Pleite, gewarnt sind aber alle. Die Händler, die künftig noch Gebrauchtwagen in Zahlung nehmen werden, müssen, wollen sie geschäftlich nicht Kopf und Kragen riskieren, auch mit Fuhrparkbetreibern Rückkaufsvereinbarungen zu sehr pessimistischen, will sagen, sehr niedrigen Preisen abschließen.
Das wiederum wird auch für die Betreiber von Kauffuhrparks die Kosten während der Laufzeit, nämlich die Abschreibungswerte, deutlich erhöhen. Ganz zu schweigen einmal davon, dass auch zähe Verhandlungen über den Fahrzeugzustand bei Rückgabe mit einem Händler, dem das Wasser bis zum Hals steht, eine zeitraubende, aufwendige und nervtötende Angelegenheit werden kann, die letztlich auch noch Geld kosten kann. Wer kaufen möchte, sollte diese Problematik besonders sorgfältig abwägen.
Nicht zuletzt bleibt es so, dass ein gekaufter Fuhrpark erhebliches Firmen-Kapital bindet, was in wirtschaftlich so schwierig zu kalkulierenden Zeiten eine ebenfalls sorgfältig abzuwägende Strategie sein sollte. Zudem steigen auch bei kaum einem Investitionsgut die Preise von Jahr zu Jahr so deutlich wie bei den Fahrzeugen. Hier ist vergleichsweise viel Geld und dann auch stetig mehr in die Hand zu nehmen.
Leasing erspart die unkalkulierbare Wiedervermarktung
Im Gegensatz dazu behält die Finanzierungsform Leasing den Konstruktionsvorteil, dass keine hohen Einmalkosten anfallen, wie hoch sie auch immer sein mögen. Leasing verursacht nur Kosten während der Laufzeit der Fahrzeuge. Ein Unternehmen, das gerade eine momentane wirtschaftliche Schwächeperiode durchlaufen oder eine solche befürchten muss, wo kalkulatorische Vorsicht geboten ist, steht wahrscheinlich dem Leasing näher. Natürlich muss es auch hier eine Bonitätsprüfung bestehen. Die Leasingraten können steuerlich abgesetzt werden.
Aufgrund der generellen Restwert-Problematik sind zwar innerhalb der letzten zwei Jahre auch die Leasingraten teils deutlich teurer geworden, hier ist es aber nach wie vor möglich, auf dem Wege eines sogenannten Multi-Supply- Konzeptes, über die Auswahl des jeweils besten Leasinganbieters je Fahrzeugmodell, Laufzeit und Laufleistung, einen marktgerechten, wirtschaftlich gesunden Mix zu finden.
Zudem bleibt dem Leasingnehmer die immer unkalkulierbarer werdende Wiedervermarktungsproblematik bei Vertragsende erspart. Damit er bei der auch hier anfallenden Fahrzeugbewertung keine bösen Überraschungen erlebt, ist es sehr empfehlenswert, ad a) Kilometer- Leasingverträge abzuschließen und ad b) bereits bei Vertragsunterzeichnung transparente Bewertungsregeln für den Zustand des Leasingrückläufers nach drei oder vier Jahren zu vereinbaren. Das ist es dann schon.
Schwierige betriebswirtschaftliche Vorteilsrechnung
Es mag in einzelnen Grenzfällen wichtig sein, welche Finanzierungsform abseits des Handlings betriebswirtschaftlich betrachtet unter dem Strich die kostengünstigste ist, was ohne die Kenntnis der besonderen Gegebenheiten im jeweiligen Unternehmen und ohne Finanz- oder Steuer-Experten nur sehr schwierig zu ermitteln ist. Hier spielen individuelle steuerliche Vorteile, bilanzielle Gesichtspunkte, Liquiditäts-Aspekte oder noch andere Faktoren mit hinein.
Ein betriebswirtschaftlich sinnvoller Vergleich würde auch voraussetzen, dass die Zeiträume der Fahrzeug-Nutzung bei Kreditkauf (betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer) und Leasing identisch wären. Das ist in der Realität oft aber so nicht gegeben, unter anderem wegen der Abschreibungsmodalitäten im Falle Kauf. Außerdem sind Kreditkauf und Leasing in der Regel mit unterschiedlichen steuerlichen Konsequenzen verbunden.
So wird beim Kreditkauf beispielsweise der Gewerbeertrag dadurch gemindert, dass die Abschreibungen und Zinsen als abzugsfähige Betriebsausgaben den Gewinn verringern. Allerdings sind dann die Kreditzinsen als „Dauerschuldzinsen” wieder zur Hälfte hinzuzurechnen. Beim Leasing findet keine Korrektur der Dauerschuldzinsen statt. Somit stellen nur die Leasingraten Betriebsausgaben dar.
Für die Berechnungen der Einsparungen an Körperschaftssteuer wiederum ist der körperschaftssteuerliche Gewinn maßgeblich. Bei dessen Ermittlung sind die Abschreibungen, Zinsen und die Gewerbeertragssteuer zu berücksichtigen. Beim Leasing sind demgegenüber die Leasingraten vermindert um die Einsparungen an Gewerbeertragsteuer zu berücksichtigen. Die Einsparungen der Gewerbeertrag- und Körperschaftssteuer ergeben die gesamten Steuereinsparungen.
Fazit: Es gibt auch oder gerade im Jahr eins nach der Finanzkrise durchaus gute Argumente für beide Finanzierungsformen. Welche für welches Unternehmen geeignet oder anzuraten ist, mag einerseits abhängig von der wirtschaftlichen Situation sein, in der sich das jeweilige Unternehmen gerade befindet. Andererseits mag auch eine Rolle spielen, ob im jeweiligen Unternehmen beim Handling des Fuhrparks eher Eigentum und inhouse-Lösungen oder ein möglichst hohes Maß an Outsourcing angesagt ist. Sicher ist nur, dass ein möglichst einfaches Handling auch indirekte Kosten vermeiden hilft.
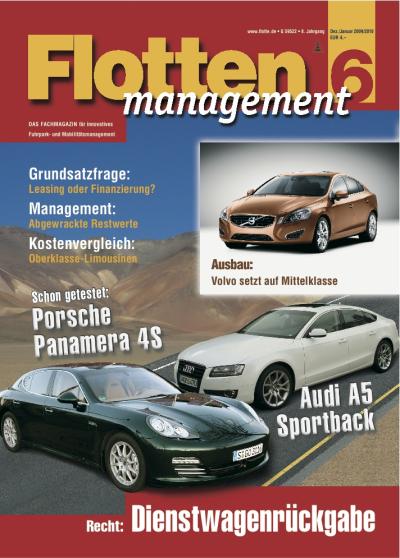
Aktuelles Magazin
Ausgabe 6/2009

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Der nächste „Flotte!
Der Branchentreff" 2026





0 Kommentare
Zeichenbegrenzung: 0/2000