Komplizierte Sache
Wer Ladeinfrastruktur plant, muss viele verschiedene Dinge berücksichtigen. Die Schritte sind durchaus anspruchsvoll und einigermaßen komplex.

PDF Download
Wer Ladeinfrastruktur plant und am Ende umsetzt, hat jede Menge vor. Vor allem stehen etliche Behördengänge an und das Warten auf Genehmigungen. Und am Anfang steht natürlich die umfassende Beratung.
Die Planung startet mit banalen Dingen wie beispielsweise dem Lastmanagement. Wie viel Strom kann überhaupt durch die vorhandenen örtlichen Leitungen fließen? Muss der Standort vielleicht ertüchtigt werden? Das wäre wiederum teuer. Und wie steht es um Pufferlösungen? Eine Pufferlösung kann eine gute Möglichkeit sein, um für gleichbleibende Ladeleistung zu sorgen. Dazu werden große Speicherbatterien eingesetzt, die gemächlich vollgeladen werden und ihrerseits hohe Ladeleistungen abgeben können. Die Kosten auch hierfür sind nicht unerheblich.
Das Ladeinfrastrukturmanagement ist also umfangreich. Es gibt auch etliche softwareseitige Herausforderungen. Je nach konkretem Einsatz können selbst simpel klingende Dinge wie Abrechnungen eine Herausforderung darstellen. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, setzt mancher Anbieter auf cloudbasierte Lösungen, um die Ladesäulen digital zu steuern. Wichtig ist auch, im Blick zu haben, ob und wo gegebenenfalls Störungen auftreten. Um unvorhergesehene Ereignisse schnell identifizieren zu können, gibt es die Lifetime-Überwachung.
Die Bürokratie ist eine drastische Hürde
Wer Ladesäulen öffentlich zur Verfügung stellt, kann von der Kreditanstalt für Wiederaufbau übrigens Förderungen erhalten. Und wer den bürokratischen Weg auf sich nimmt, kann hier Kosten einsparen bei der Investition in einen langfristigen Standortvorteil.
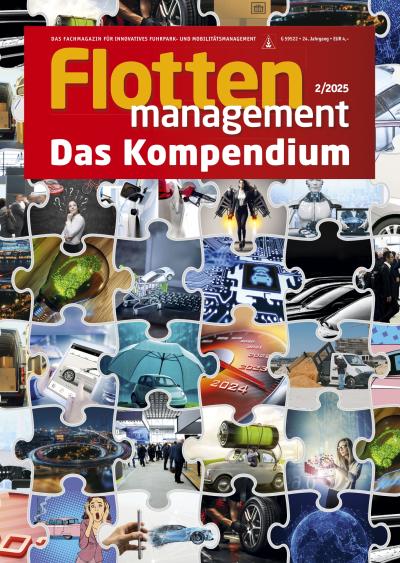
Aktuelles Magazin
Ausgabe 2/2025

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Doch warum überhaupt Ladeinfrastruktur – insbesondere am Arbeitsplatz? Nun, um die Elektromobilität in die Breite zu tragen, sind flächendeckende Lademöglichkeiten unabdingbar. Und wenn jemand nicht zu Hause laden kann, dann aber vielleicht am Arbeitsplatz – so etwas hilft, um potenziellen Elektroautokunden schon rein psychologisch den gedanklichen Zugang zum lautlosen Vehikel etwas einfacher zu machen. Öffentliche Gleichstrom-Ladeplätze mit hohen Ladeleistungen sind zwar überaus wichtig, allerdings sperren sich viele User dagegen, elektrisch zu fahren, wenn sie mit Wartezeit konfrontiert werden – und das ist beim Öffentlichen Laden meist der Fall, denn selten befindet sich der Ladeplatz dort, wo der individuelle Nutzer sich ohnehin für eine längere Zeit aufhält. Lädt das Auto hingegen am Arbeitsplatz, ist die Wartezeit schließlich perfekt überbrückt.
Wer Ladeinfrastruktur schaffen will, hat verschiedene Möglichkeiten, den Prozess anzugehen. Kleinere Unternehmer, die weder Kapazität noch Zeit haben, um sich mit der Materie zu beschäftigen, können die Dienstleistungen der Ladespezialisten in Anspruch nehmen. Basiskenntnisse darüber, wer welche Funktion innehat, schaden sicherlich nicht. Was ist beispielsweise ein „CPO“, also ein Charging Point Operator? Oder worin besteht der Unterschied zwischen einem – um es mal ins Deutsche zu übersetzen – Ladepunktbetreiber sowie einem Elektromobilitätsdienstleister
Ladenetz wächst und wächst
Wenn man seine Ladesäulen der Öffentlichkeit anbietet, muss der Nutzer mit
der Ladesäule interagieren. Es muss also einen geregelten Zugang geben per App oder sogenannter Ladekarte (RFID). Der Dienstleister ist allerdings nicht zwingend der Eigentümer der Ladeinfrastruktur. Ebenso wenig übrigens wie der Charging Point Operator. Er baut und installiert allerdings die Ladesäule. Außerdem wartet er sie auch – wichtiges Thema.
Neben den CPO bilden die Unternehmen das Rückgrat für das Funktionieren der Elektromobilität, indem sie Standorte zur Verfügung stellen und für eine stetige Erweiterung des Netzwerks sorgen.
Damit viele Autos gleichzeitig laden können, ist im Hintergrund indes gewaltige Rechenleistung erforderlich. Denn je nach Abfrage von Strommengen entstehen nicht nur Engpässe im Netz, was die Ladeleistungen reduziert, sondern darüber hinaus Netzgebühren. Mittels Software kann man bei langsam ladenden Fahrzeugen durch kurzzeitige Reduktion der Ladeleistung Lastspitzen vermeiden – im Fachjargon „Peak Shaving“ genannt. An der Schnellladesäule wäre das allerdings ein ärgerliches Unterfangen, denn hier will der Nutzer schließlich möglichst schnell Strom in seinen Hochvoltspeicher bekommen.
Fazit: Ladestrukturmanagement ist ein komplexes Unterfangen, das bloß große Unternehmen in Eigenregie bewältigen können. Kleinere Firmen haben allerdings die Möglichkeit, verschiedene Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Hürden gibt es vor allem im Bereich der Bürokratie. Genehmigungen lassen grüßen. Wer sein Ladenetz öffentlich zur Verfügung stellen will, kann gleich verschiedene Vorteile genießen. Abgesehen von den Förderungen, die in einem solchen Fall winken, ist es ja auch schön, wenn der Ladepunkt später in den einschlägigen Ladeapps erscheint. Denn nur so kann er gefunden werden, um vorbeifahrenden Elektroautofahrern mit endenden Stromreserven den Weg zur Ladesäule zu weisen.
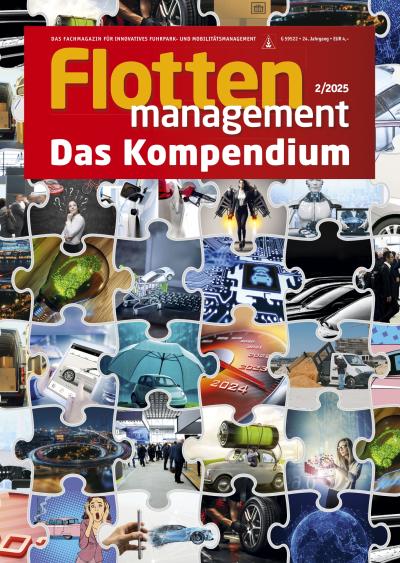
Aktuelles Magazin
Ausgabe 2/2025

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Der nächste „Flotte!
Der Branchentreff" 2026




0 Kommentare
Zeichenbegrenzung: 0/2000