Allgemeine Haftungsfragen der Halterhaftung und -verantwortung
Der Einsatz von Kraftfahrzeugen im Unternehmensfuhrpark ist eine ebenso nützliche wie potenziell gefährliche Angelegenheit.

PDF Download
Fahrzeuge ermöglichen die individuelle Mobilität der Unternehmensmitarbeiter, unterstützen das Tagesgeschäft beispielsweise im Vertriebsaußendienst sowie im Service und bewerkstelligen den Transport von Waren. Mit dieser nützlichen Mobilitäts- und Einsatzmöglichkeit sind bedingt durch die Umstände des modernen Straßenverkehrs auch zahlreiche Risiken verbunden, und zwar in erster Linie Verkehrsunfallrisiken.
Dass Verkehrsunfälle mit Firmenfahrzeugen im Prinzip nahezu unvermeidlich sind, ist eine unbequeme, aber lediglich statistische Angelegenheit. Dem hat der Gesetz- und Verordnungsgeber dadurch Rechnung getragen, dass er im Straßenverkehrsrecht eine Unzahl von Haftungsbestimmungen und Sanktionen erlassen hat, die in allererster Linie den Fahrer treffen. Straf- und bußgeldrechtliche Folgen können sich aber auch für den Fahrzeughalter ergeben, wenn Verstöße gegen Auswahl-, Belehrungs- und Überwachungsvorschriften vorliegen oder sonstige Organisationsfehler begangen werden. Es versteht sich von selbst, dass der Fuhrpark als Unternehmensteil regelkonform geführt werden muss. Das bedeutet, dass Unternehmen und die Unternehmensverantwortlichen verpflichtet sind, dafür Sorge zu tragen, dass keine Gesetzesverstöße im Fuhrpark oder mit Dienstfahrzeugen erfolgen. Das Bedürfnis nach Rechtssicherheit im Fuhrpark erfordert auch, die Prozesse an die rechtlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen anzupassen. Dies bringt neben einer enormen Verantwortung auch gewisse Haftungsrisiken mit sich.
Halterverantwortung und Haftung
Für das gesamte Verkehrsrecht gilt ein einheitlicher Halterbegriff. So legt das Straßenverkehrsrecht nahezu alle aus der Zulassung und dem Betrieb eines Fahrzeugs folgenden Pflichten ausdrücklich dem Halter auf: Verantwortlicher Halter eines Fahrzeugs ist derjenige, der regelmäßig, tatsächlich und vornehmlich wirtschaftlich über die Ingebrauchnahme des Kfz, also über die Gefahrenquelle Kfz, bestimmen kann.
Nach der allgemeinen Definition der Rechtsprechung ist Halter eines Fahrzeugs, wer das Kraftfahrzeug für eigene Rechnung in Gebrauch hat und die entsprechende Verfügungsgewalt hierüber besitzt. Die Strafvorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 2 StVG bezieht sich damit auf die tatsächliche Rechtsstellung, nicht darauf, wer im Fahrzeugregister und in den Fahrzeugpapieren als Halter eingetragen ist. Letzteres ist nur regelmäßig ein wichtiges Indiz für die tatsächliche Lage. Demnach ist diejenige Person Halter eines Fahrzeugs, die tatsächlich über die Fahrzeugbenutzung verfügen kann – also Anlass, Ziel und Zeit seiner Fahrten selbst bestimmt. Damit steht regelmäßig das Unternehmen in der Halterverantwortung, welches das Fahrzeug angeschafft hat und den Fuhrpark unterhält.
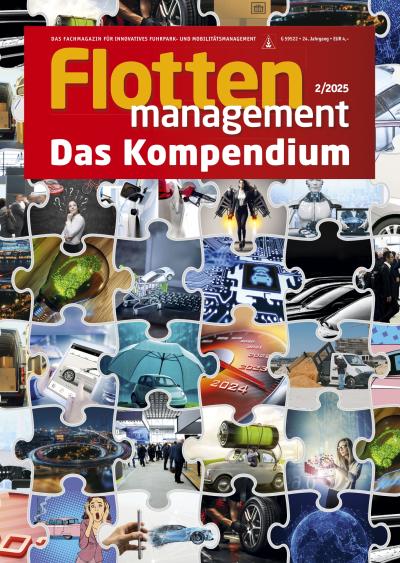
Aktuelles Magazin
Ausgabe 2/2025

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Halter von Firmenfahrzeugen ist gewöhnlich der Betriebsinhaber. Ist dies eine juristische Person oder ein Personenverband, haften die vertretungsberechtigten Organe beziehungsweise die Vertretungsberechtigten. Haftungstechnisch ist als Halter insoweit primär die Geschäftsleitung verantwortlich gemäß § 14 Abs. 1 StGB bzw. § 9 Abs. 1 OWiG. Dies sind zum Beispiel der Vorstand einer AG oder der Geschäftsführer einer GmbH. Sind die Leitungsaufgaben im Unternehmen auf mehrere Personen verteilt, ist es möglich, dass beispielsweise eine bestimmte Leitungsperson nur für den Fuhrpark zuständig und damit auch verantwortlich ist. Oftmals können die zuständigen Leitungspersonen den Halterpflichten nicht persönlich nachkommen. Daher ist anerkannt, dass sie die fuhrparkbezogenen Halteraufgaben auch delegieren können. Gerade in größeren Unternehmen ist dies an der Tagesordnung. Wer sich als Geschäftsführer oder Vorstand nicht selbst um jedes einzelne Fahrzeug und die Fahrer kümmern kann, sollte beispielsweise die mit der Halterhaftung verbundene Pflicht zur Führerscheinkontrolle auf (unternehmensinterne oder -externe) zuverlässige und sachkundige Dritte übertragen.
Der Fuhrparkmanager kann daher sekundärer Verantwortlicher sein nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 StGB, § 9 Abs. 2 Nr. 2 OWiG. Bei einer Delegation treffen die Halterpflichten den Fuhrparkmanager unmittelbar. Wesentlich ist, dass die Person, welche die Halteraufgaben übernehmen soll, ausdrücklich beauftragt wird, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem Inhaber des Betriebs obliegen. Dabei soll das Merkmal der „ausdrücklichen“ Beauftragung (§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StGB, § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 OWiG) gewährleisten, dass der Beauftragte im Fuhrpark eine klare Vorstellung über Art und Umfang des ihm übertragenen Auftrags hat. Dies dient letztlich der Herstellung einer korrekten Organisation. Neben einer Verantwortung für aktives Tun kann der Fuhrparkmanager, wie auch der Halter, für das Unterlassen organisatorischer oder konkreter Maßnahmen haften (§ 13 StGB, § 8 OWiG). Es macht daher Sinn, die rechtswirksame Delegation der Halteraufgaben von der Unternehmensleitung auf den Fuhrpark im Auge zu behalten und hierbei auch die diesbezügliche Arbeitsplatz- und Aufgabenbeschreibung der Fuhrparkmitarbeiter zu berücksichtigen.
Delegation von Halteraufgaben – wie geht das?
Die Halterpflichten können von der Geschäftsführung eines Unternehmens auf andere ausgewählte Personen im Unternehmen, wie einen (internen) Fuhrparkleiter, übertragen beziehungsweise delegiert werden. Diese Pflichtendelegation kann auf ganz unterschiedliche Weise erfolgen:
• über gesetzliche Vorschriften
• über den Arbeitsvertrag
• über die zum Arbeitsvertrag gehörende Stellenbeschreibung des Fuhrparkleiters
• aus der Funktion, in welcher der jeweilige Mitarbeiter (und sei es nur als quasi nebenberuflicher Fuhrparkleiter) faktisch tätig ist.
• aufgrund einer gesonderten Beauftragung oder sonstigen einzelvertraglichen Regelung.
Vertraglich zu regeln wäre auch die Delegation an externe Fuhrparkleiter oder Unternehmen. Denn der Beauftragte muss nicht dem Unternehmen des Fahrzeughalters angehören; es können auch betriebsexterne Personen oder andere Unternehmen mit dem Fuhrparkmanagement betraut werden. Angesichts der erheblichen logistischen Anforderungen bei der Verwaltung großer Fuhrparks wird hiervon nicht selten Gebrauch gemacht.
Die Umsetzung der Delegation von Halterpflichten kann zwar formfrei erfolgen. Aus Nachweisgründen sollte sie aber stets ausdrücklich und möglichst schriftlich dokumentiert werden. Aus dieser Pflichtendelegation resultiert dann zwangsläufig auch eine Übertragung der Haftung. Mit einer Delegation der Halterverantwortlichkeit kann die Geschäftsleitung also ihre eigene Haftung entweder einschränken oder sogar völlig ausschließen.
Eine wirksame Pflichtendelegation setzt jedoch voraus, dass die Geschäftsführung als verantwortlichen Fuhrparkleiter eine zuverlässige, erprobte und sachkundige Person ausgewählt und mit der Erfüllung der Halterpflichten ausdrücklich beauftragt hat. Besonders wichtig ist, dass die Erfüllung der Halterpflichten „in eigener Verantwortung“ des ausgewählten Fuhrparkleiters liegt. Erforderlich ist, dass der Fuhrparkleiter als Halterbeauftragter der Geschäftsleitung eine klare Vorstellung von der Art und dem Umfang der von ihm in eigener Verantwortung zu erfüllenden Tätigkeiten hat. Außerdem muss er die Befugnis erhalten, die zur Erfüllung dieser Pflichten notwendigen Entscheidungen selbständig und ohne Weisung des Halters oder dessen gesetzlichen Vertreters zu treffen.
Folgen einer wirksamen Delegation
Einen durch Pflichtendelegation in die Halterverantwortung genommenen Fuhrparkmanager treffen die Pflichten eines Fahrzeughalters unmittelbar. Eine weitergehende Pflichtendelegation „nach unten“ in der Hierarchie der Fuhrparkverwaltung ist nur möglich, wenn sie ausdrücklich gestattet wurde. So kann es Sinn machen, trotz einer zentralen Organisation des Fuhrparks bei mehreren Standorten sogenannte lokale Fuhrparkverantwortliche für die Pflichtendelegation auszuwählen. Damit werden zugleich nicht unerhebliche zivil- und strafrechtliche Haftungsrisiken begründet. So droht zum Beispiel bei Schadenfällen mit Verletzung zivilrechtlicher Halterpflichten eine Schadensersatzhaftung bis hin zu einem Regress des Fuhrparkbetreibers gegen den Fuhrparkleiter. Eine entsprechende Vermögensschadenhaftpflichtversicherung sollte daher nicht fehlen. Der Fuhrparkleiter muss als Verantwortlicher für die Firmenfahrzeuge und für deren Zustand im öffentlichen Straßenverkehr Kontrollpflichten (Flottenwartung) wahrnehmen, um eine Haftung zu begrenzen oder auszuschließen. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und die Kontrolle des Führerscheins. Der Fuhrparkleiter kann sich dabei nicht auf Auskünfte der Fahrer verlassen. Er muss vielmehr die Kontrollen selbst vornehmen oder vornehmen lassen und eine Dokumentation dieser zu Nachweiszwecken sicherstellen.
Haftung der Geschäftsleitung trotz Pflichtendelegation
Mit der Delegation allein ist es nicht getan. Der Satz „Aus den Augen, aus dem Sinn“ gilt hier nicht. Die Delegation der Halterpflichten auf die Fuhrparkleitung darf für die Geschäftsleitung also kein Grund sein, die Hände in den Schoß zu legen. So kann die Geschäftsleitung zwar ihre Halterverantwortlichkeit für die Verkehrssicherheit der Firmenfahrzeuge auf andere Personen übertragen, dennoch bleiben gewisse Überwachungspflichten der Geschäftsleitung gegenüber dem Fuhrparkmanagement bestehen. Die Unternehmensleitung haftet nämlich weiterhin subsidiär nach den Grundsätzen der Organ- und Vertreterhaftung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 StGB bzw. nach § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 OWiG.
Zu beachten ist insbesondere, dass eine Pflichtdelegation nicht die eigene originäre Verantwortlichkeit der Unternehmensleitung für die Bestellung, sorgfältige Auswahl und Überwachung von Aufsichtspersonen nach § 130 OWiG ersetzen kann. Fehlt die Organisation des Fuhrparks völlig oder ist diese mangelhaft, verbleibt es bei der Haftung der Unternehmensleitung. Daher ist die regelmäßige Überwachung der Fuhrparkleitung durch die Geschäftsleitung mittels stichprobenartiger und unangekündigter Kontrollen im Hinblick auf die Erfüllung der übertragenen Aufgaben geboten. Es versteht sich von selbst, dass diese Kontrollen zu Nachweiszwecken hinreichend dokumentiert werden müssen.
In der Sache ist die Verantwortung des Halters und des Halterverantwortlichen nach Delegation für alle Typen von Firmenfahrzeugen und Dienstwagen haftungsrechtlich gleichgestellt, unabhängig davon, ob es sich um ausschließlich dienstlich genutzte Fahrzeuge oder um Dienstwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit handelt. Bei Leasingfahrzeugen ist meist geregelt, dass der Leasingnehmer in der Regel alleiniger Halter ist. Auch die Haftungsvorschriften aus den unterschiedlichsten Rechtsgebieten knüpfen meist an die Halterverantwortlichkeit an. Diese kann bei entsprechender Aufgabendelegation im Fuhrpark liegen.
Deutlich wird die Haftung bei Delegation am Beispiel der Überladung: Für die ordnungsgemäße Ladung ist in erster Linie der Fahrer verantwortlich. Dass der Halter als sein Arbeits- beziehungsweise Auftraggeber die Überladung nicht veranlassen darf, dürfte auf der Hand liegen. Der Fahrzeughalter kommt seinen Pflichten durch die sorgfältige Auswahl der Fahrer, Weisungen sowie Überwachung durch stichprobenartige Kontrollen nach. Der Halter darf einem sorgfältig ausgewählten, belehrten und überwachten Fahrer die Entscheidung überlassen, ob ein bestimmtes Transportgut noch nicht zu einer Überladung führt. Ist der Halter jedoch länger seinen Kontrollpflichten in Bezug auf die Beladung nicht nachgekommen, ist auch er für die Überladung mitverantwortlich. Diese Pflichten folgen unmittelbar aus § 31 Abs. 2 StVZO, weshalb bei Ladungsverstößen kein Rückgriff auf § 130 OWiG erfolgt. Ähnlich liegt es bei Geboten nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG).
Überwachungs- und Kontrollpflichten im Fuhrparkmanagement
Ein elementarer Teil des Pflichtenprogramms für den Fahrzeughalter findet sich zusammengefasst im Rahmen des § 31 Abs. 2 StVZO. So darf der Halter hiernach die Inbetriebnahme eines Dienstwagens nicht anordnen oder zulassen, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass der Führer nicht zur selbstständigen Leitung geeignet ist oder das Fahrzeug, der Zug, das Gespann, die Ladung oder die Besetzung nicht vorschriftsmäßig sind. Gleiches gilt, wenn die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung leidet. Die Verletzung dieser Pflichten wird mit einer Geldbuße geahndet (§ 69a Abs. 5 Nr. 2, 3 StVZO).
Zu den zentralen haftungsrelevanten Pflichten im Fuhrpark gehören daher insbesondere:
• die Regelung der Dienstwagenüberlassung
• die Kontrolle der Fahrer durch:
- Fahrerunterweisung
- Führerscheinkontrolle
- Eignungsprüfung (z. B. Umgang mit alkoholisierten Fahrern, Fahrern unter Medikamenteneinfluss):
- Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten (Aufzeichnungspflichten):
- Regelung des Umgangs mit Ordnungswidrigkeiten im Fuhrpark.
- Die Überwachung der ordnungsgemäßen Führung behördlich angeordneter Fahrtenbücher.
• und aus dem Bereich der technischen Flottenwartung:
- die Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften.
- die Überwachung der Durchführung von Fahrzeugkontrollen.
- die Einhaltung der Vorschriften über Ladung und Ladungssicherung (Haftung für Überladung);
- die Einhaltung der Feinstaubverordnung.
• die Einhaltung des Datenschutzes nach der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
• sowie die Steuerung des Schadenmanagements als Kehrseite der zivilrechtlichen Halterhaftung nach § 7 StVG.
Strafrechtliche Aspekte der Halterhaftung
Im Fokus der Betrachtung steht hier meist das Anordnen oder Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach § 21 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 3 StVG. Darüber hinaus kommt auch eine strafbare Beteiligung an Fahrten im Zustand der Fahrunsicherheit, vor allem bei Trunkenheitsfahrten nach §§ 315c, 316 StGB, in Betracht.
Kommt es bei Fahrten mit dem Dienstwagen zu Personenschäden oder gar Todesfällen, ist auch an eine Verantwortlichkeit des Halters nach §§ 222, 229 StGB zu denken. Die strafrechtliche Haftung für Körperverletzungs- und Todesfolgen von Fahrten mit dem dienstlichen Kraftfahrzeug ist recht weit gefasst.
So können beispielsweise Sorgfaltsverstöße bei der Fuhrparkorganisation, die zeitlich noch weit vor dem eigentlichen Unfallereignis liegen, grundsätzlich zu einer Strafbarkeit führen. Hinsichtlich der betriebsinternen Verantwortlichkeit ist daher zu beachten, dass die Delikte der fahrlässigen Tötung nach § 222 StGB und der fahrlässigen Körperverletzung nach § 229 StGB als Allgemeindelikte von „jedermann“ begangen werden können, wobei die oben genannten Grundsätze zur Verantwortung nach § 14 StGB im Unternehmen hier nicht greifen. Die Strafbarkeit des Betriebsinhabers und des Fuhrparkverantwortlichen bestimmt sich hier vielmehr nach den allgemeinen strafrechtlichen Regeln, wobei unter anderem die Beurteilung, ob ein Tun oder Unterlassen vorliegt und wie sich Täterschaft oder Teilnahme an der Tat darstellen, durchaus komplexe Haftungsfragen aufwerfen kann. Diese strafrechtlichen Risiken können aber durch eine ordnungsgemäß nachgewiesene Delegation vermieden werden, sofern ansonsten kein Organisationsdefizit vorliegt. In der Praxis kommen Strafverfahren wegen Fallgestaltungen mit Körperverletzungs- oder Todesfolge gleichwohl kaum vor. Eine strafrechtliche Haftung des Halterverantwortlichen nach §§ 222, 229 StGB, der seine Fahrer mit verkehrsunsicheren, überladenen, falsch besetzten Fahrzeugen in den Verkehr schickt, liegt zwar nahe, wenn die Mängel unfallursächlich werden und es zum Personenschaden kommt. Jedoch gibt es hierzu kaum veröffentlichte Rechtsprechung.
Insbesondere: Die Pflicht zur Führerscheinkontrolle im Fuhrpark
Die Führerscheinkontrolle im Fuhrpark gehört zu den zentralen Pflichten der Halterverantwortung im Fuhrpark. Eine gesetzliche Regelung dazu gibt es jedoch nicht. Was der Fahrzeughalter im Rahmen der Fahrzeugüberlassung an Dritte zur Führerscheinkontrolle zu organisieren und zu veranlassen hat, ist nirgendwo geregelt. Damit fehlt es an einer „positiven“ Rechtsregelung zur Führerscheinkontrolle.
Die Verpflichtung zur Führerscheinkontrolle im Fuhrpark ergibt sich allerdings aus einer „negativen“ Regelung, die bei Nichteinhaltung zu strafrechtlichen Konsequenzen führen kann: Will sich der Halter nicht selbst nach § 21 StVG wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar machen, dann darf er niemanden ans Steuer lassen, der keine Fahrerlaubnis besitzt oder der gerade ein Fahrverbot verbüßt.
Der Fahrzeughalter und damit der Fuhrparkverantwortliche ist zur Führerscheinkontrolle verpflichtet, da er persönlich strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn er jemandem ein Fahrzeug überlässt, der entweder nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt oder der gerade ein Fahrverbot verbüßt. Das ergibt sich aus dem Straftatbestand des § 21 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 3 StVG. Danach haftet der Fahrzeughalter (beziehungsweise der Halterverantwortliche im Fuhrpark) strafrechtlich persönlich, wenn er es anordnet oder zulässt, dass jemand ein Fahrzeug führt, der die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht (oder nicht mehr) besitzt oder dem das Führen eines Kraftfahrzeugs nach § 44 StGB oder nach § 25 StVG durch ein Fahrverbot zeitweise untersagt ist. Bei Verstößen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe; bei Fahrlässigkeit immerhin eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen.
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt
Auch unter dem Blickwinkel denkbarer Haftungsvorschriften muss die prozessorientierte Steuerung von Fuhrparkabläufen stets der konkreten Unternehmensorganisation entsprechen. Nach der rheinischen Redensart „Jeder Jeck ist anders“ muss sich die Ausübung der Halterverantwortlichkeiten stets an der konkreten Unternehmensorganisation und den individuellen internen Abläufen orientieren. Es macht eben einen Unterschied, ob das Fuhrparkmanagement eine eigenständige Abteilung mit einem gut ausgebildeten Fuhrparkmanager ist oder ob der Fuhrpark quasi nebenbei mit einer Vielzahl von anderen Aufgaben durch „Management by Corner“ (wer um die Ecke kommt, hat den Job) übertragen wird. Auch wenn die grundlegenden Haftungslagen im Fuhrpark unabhängig von Fuhrparkgröße und -struktur regelmäßig die gleichen sind, ist es doch haftungstechnisch ganz entscheidend, wie das Unternehmen selbst aufgestellt ist, wie die Abläufe im Unternehmen konkret organisiert sind und welche entscheidungsbefugten Mitarbeiter aus dem Fuhrpark oder anderen Abteilungen oder Unternehmensteilen hier eingebunden sind.
Da nicht alle rechtlichen Risiken auch durch D&O-Versicherungen oder eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abgedeckt werden können, ergibt es durchaus Sinn, sich gegebenenfalls auch rechtlich beraten zu lassen.
RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER ist zugleich Syndikusrechtsanwalt und Mitglied der ARGE Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein. Ein besonderer Kompetenzbereich liegt im Bereich des Mobilitäts-, Dienstwagen- und Verkehrsrechts. Seine Schwerpunkte bei der Dienstwagenüberlassung und der betrieblichen Mobilität liegen insbesondere beim autonomen Fahren, Elektromobilität sowie Mobilitätsbudgets mit weiteren Bezügen zu Zivil-, Arbeits- und Steuerrecht, Schadenmanagement und Datenschutz. Als Autor hat er zahlreiche Publikationen zum Dienstwagenrecht veröffentlicht. Als Referent hält er bundesweit offene Seminare und Inhouse-Veranstaltungen zur Dienstwagenüberlassung.
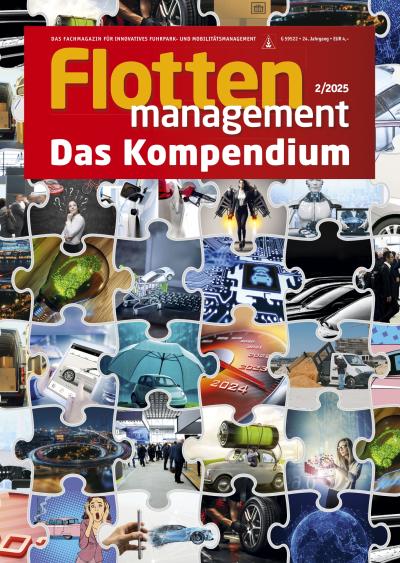
Aktuelles Magazin
Ausgabe 2/2025

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Der nächste „Flotte!
Der Branchentreff" 2026







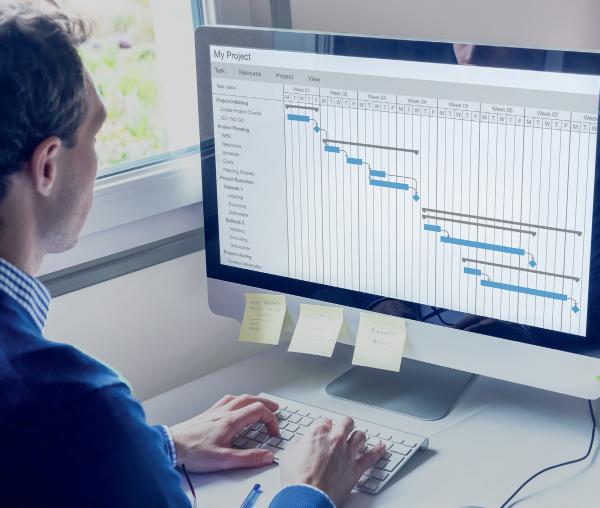

0 Kommentare
Zeichenbegrenzung: 0/2000