Hätten Sie’s gewusst?
<p>Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in unserer Rubrik.</p>

PDF Download
GIBT ES EIGENTLICH REGELN FÜR BLINKER UND DEREN BENUTZUNG
Der Fahrtrichtungsanzeiger, umgangssprachlich auch Blinker genannt, erfüllt eine Reihe von wichtigen Funktionen. Jedoch bestehen für ihn selbst wie auch seinen Einsatz spezielle Vorgaben, die einerseits wenig bekannt und andererseits in der StVO nicht eindeutig formuliert sind.
Zuerst einmal muss ein Blinker gelbes Licht aussenden, getunte Farben, beispielsweise Rot, sind nicht zulässig. Allerdings waren vor 1970 hintere rote Blinker erlaubt. Ab einer Fahrzeuglänge von sechs Metern ist zusätzlich zu den Leuchten vorne und hinten an den Außenrändern ein Seitenblinker anzubringen. Mittlerweile statten aber die meisten Autohersteller alle ihre im Angebot befindlichen Pkw mit zusätzlichen Seitenblinkern (in die Seiten-/Außenspiegel integriert) aus. Die Blinkfrequenz ist mit 1,5 Hz ± 0,5 Hz vorgeschrieben, das sind 90 ± 30 Lichtzeichen pro Minute. Viele Hersteller verdoppeln als Warnsignal die Blinkfrequenz auf der Seite, wenn dort ein Leuchtmittel ausgefallen ist. Die akustische Rückmeldung durch das charakteristische Klick-klack-Geräusch ist nicht zwingend vorgeschrieben. Ebenso ist die Rückstellung des Blinkers beim Geradestellen des Lenkers technisch nicht vorgeschrieben, aber heutzutage bei allen Fahrzeugherstellern Standard. Interessanterweise mussten bis 1956 laut StVO Fahrtrichtungsanzeiger die Kontur oder Form des Fahrzeugs verändern. Fest installierte Blinker, wie wir sie kennen, sind erst seit 1956 für den Einbau in Neuwagen vorgeschrieben. Der Vorgänger des Blinkers war ein „Winker“, die erste technische Realisierung eines blinkenden Richtungsanzeigers. Dabei handelte es sich um ein Blinklicht an einem Klappstab, der im Mittelholm verankert war. Diese technisch sehr aufwendige Installation war insbesondere für Fußgänger und Radfahrer aus naheliegenden Gründen gefährlich. Zudem führte bei höherer Geschwindigkeit der Fahrtwind zu Problemen mit dem Klappmechanismus. Historisch gesehen hat tatsächlich Bosch 1925 den ersten elektrisch ausklappbaren und zudem beleuchteten Fahrtrichtungsanzeiger gebaut.
Für den genauen Einsatz des Blinkers gibt es wie so häufig keine wirklich konkreten Angaben in der StVO. Dort steht in § 9 (Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren) in Absatz 1: „Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und deutlich ankündigen; dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen.“ Dabei kommt natürlich sofort die Frage auf, was mit „rechtzeitig“ gemeint ist. Eine fast einhellige Meinung dazu ist, dass ein Blinker mindestens dreimal aufgeleuchtet haben muss, um dieses Minimalkriterium zu erfüllen. Das ist wohl auch der Grund, warum die sogenannten Komfortblinker, die durch einmaliges Antippen des Blinkers aktiviert werden, genau dreimal aufleuchten. Bei einem Spurwechsel oder beim Abbiegen ist der Blinker solange zu setzen, bis der Vorgang komplett abgeschlossen ist. Das gilt natürlich ebenso beim Abbiegen nach einer Ampel. In welcher Entfernung vor einem Abbiegevorgang der Blinker gesetzt werden sollte, ist ebenfalls nicht offiziell geklärt. Laut Dekra-Experten sind das aber mindestens 30 Meter. Das Blinken ganz zu vergessen kostet übrigens 10 Euro, ist der Blinker defekt oder zum Beispiel verdreckt, sind 15 Euro fällig. Wird dadurch jemand gefährdet, sind es schon 30 Euro, mit Sachbeschädigung 35 Euro. Bei einem Unfall droht sogar eine Mitschuld.

Aktuelles Magazin
Ausgabe 4/2023

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
WAS GESCHIEHT EIGENTLICH MIT EINEM E-AUTO MIT LEEREM AKKU
Die Frage ist ja an sich nicht neu, können doch auch Verbrenner aufgrund eines leeren Tanks liegen bleiben. Bei der Bemessung des Bußgeldes ist daher erst mal kein Unterschied zwischen Verbrenner und Elektroauto oder auch Hybrid zu machen. Hier muss man berücksichtigen, wo sich der Stillstand einstellte. Innerhalb geschlossener Ortschaften ist es ja häufig noch möglich, auf einen Seitenstreifen oder Parkplatz zu rollen. Sollte das Fahrzeug aber auf der Fahrbahn liegen bleiben, so muss mit einem Bußgeld von 30 Euro gerechnet werden. Außerhalb geschlossener Ortschaften könnte man noch versuchen, beispielsweise auf einen Feldweg zu gelangen, ansonsten fallen auch hier 30 Euro an.
Das gilt aber nur, wenn es sich nicht um Autobahnen oder Kraftfahrstraßen handelt. Denn dort, also insbesondere auf dem Seitenstreifen, dürfen nur Fahrzeuge abgestellt werden, die aufgrund einer Panne oder eines Unfalls nicht mehr fahrtüchtig sind. Bei einem leeren Akku oder Tank geht man aber von Eigenverschulden aus und bewertet das als Parken mit Behinderung im Sinne einer vermeidbaren Verkehrsbehinderung. Und damit steigt das Bußgeld auf 70 Euro plus einen Punkt in Flensburg. Man muss aber dazusagen, dass man mindestens drei Minuten auf dem Seitenstreifen stehen muss, ansonsten wird das wie üblich als Halten interpretiert und kostet „nur“ 30 Euro. Das Fahrzeug innerhalb von drei Minuten wieder mit Energie zu versorgen, dürfte allerdings schwierig sein.
Soweit die parallele Betrachtung von Elektrofahrzeugen und Verbrennern. Nun ergibt sich bei genauerem Hinsehen aber ein wesentlicher Unterschied. Bei Verbrennern hat man immer die Option, einen oder mehrere Reservekanister mitzuführen. In Deutschland, und da reibt man sich die Augen, dürfen Reservekanister bis zu 60 Liter Kraftstoff beinhalten und davon darf man vier Stück (also 240 Liter) an Bord haben. Empfohlen werden aus Sicherheitsgründen aber maximal zehn Liter.
Hier ist das Elektroauto wesentlich sperriger. Zumal langes Stehen im Stau und die Klimaanlage in Betrieb schnell einen Engpass bewirken können. Hier könnte man an eine überdimensionale Powerbank denken, die im Fahrzeug mitgeführt wird. Solche Produkte gibt es mittlerweile, aber diese sind fast 25 Kilogramm schwer, haben das Format eines Trolleys und liefern nach einer Stunde Ladezeit immerhin Saft für 65 Kilometer. Der ADAC experimentiert selbst mit E-Boostern, das sind mobile Ladestationen für unterwegs. Allerdings bieten auch die Hersteller Servicehotlines an, bei denen man Hilfe anfordern kann. Vom Abschleppen ist wie bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe unbedingt abzusehen. Da bleibt dann in diesen Fällen nur der Abtransport. Allerdings sind leere Fahrakkus nur selten ein Pannengrund laut ADAC.

Aktuelles Magazin
Ausgabe 4/2023

Sonderausgabe Elektro
Das neue Jahresspecial Elektromobilität.
Der nächste „Flotte!
Der Branchentreff" 2026

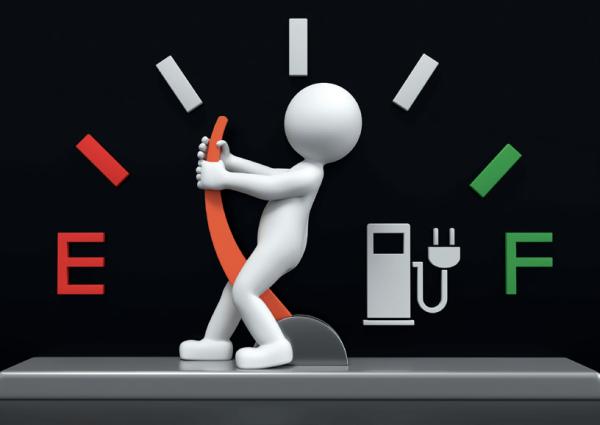
0 Kommentare
Zeichenbegrenzung: 0/2000